Übersicht
Biologische Vielfalt in NürnbergBelebte GroßstadtNürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bayerns. Der Kampf um freie Fläche ist somit vorprogrammiert. Man könnte meinen, dass Flora und Fauna da schnell verdrängt werden. Doch das stimmt nicht ganz - Nürnberg tut viel, um Biodiversität zu bewahren und zu fördern. Erfahren Sie in dieser Webreportage mehr über artenreiche Lebensräume, spannende Projekte zum Erhalt der Artenvielfalt und zu bewältigende Herausforderungen.
Lebensräume
In Nürnberg gibt es zahlreiche Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Entdecken Sie die unterschiedlichen Orte und deren Bedeutung für die Artenvielfalt.
Herausforderungen
Das Insektensterben ist keine Illusion und in einer Großstadt wird immer um freie Flächen gekämpft - Wie geht man damit um? Lernen Sie von Experten, was es heißt, mit solchen Herausforderungen tagtäglich konfrontiert zu werden.
Bündnis für Biodiversität
Pflanzen und Tiere schützen, Lebensraum bewahren, Bürger aufklären - Dafür steht Nürnbergs Bündnis für Biodiversität. Wer genau dahinter steckt, können Sie hier erfahren.
Initiative
Schon kleinste Veränderungen haben eine große Wirkung. Erfahren Sie mehr über ein spannedes Projekt zur Rettung der Bienen und holen Sie sich Tipps für den heimischen Garten.
Impressum
Eine Bachelorarbeit der Hochschule Ansbach im Studiengang Multimedia und Kommunikation.
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für ihre Unterstützung.
Die Erstellung erfolgte unter der Betreuung von Herrn Prof. Dr. Markus Paul in Kooperation mit dem Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg. Besonderer Dank gilt Frau Hiltrud Gödelmann, die mir bei allen Fragen jederzeit zur Seite stand.
Verantwortlich im Sinne des §55 Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrags:
Jessica Wicklein
90513 Zirndorf
jessica.wicklein@hs-ansbach.de
Bilder
Weisstorch: Martin Kittsteiner
Fledermäuse: Detlev Cordes
Erdkröte, Kreuzkröte, Feuersalamander + Anlageplan: Freiland-Aquarium und Terrarium, Stein / NHG
Musik
Stadtgarten:
"Blood" by Scott Buckley
www.scottbuckley.com.au
Dutzendteich:
"Elementary" by Scott Buckley
www.scottbuckley.com.au
Beedabei:
"Childhood" by Scott Buckley
www.scottbuckley.com.au
Rotkopfschafe:
"SOLO ACOUSTIC GUITAR" by Jason Shaw
http://freemusicarchive.org/music/Jas...
Creative Commons — Attribution 3.0 United States— CC BY 3.0 US
http://creativecommons.org/licenses/b...
Music promoted by Audio Library
https://youtu.be/4M9Puanhdac
Kindergruppe Bund Naturschutz:
"On the Way" by Vlad Gluschenko
https://soundcloud.com/vgl9 Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: http://bit.ly/_OntheWay
Music promoted by Audio Library
https://youtu.be/QwwuuvnfBlA
Nistkasten:
"Sunny" from Bensound.com
Landkarte
OpenStreetMap
Open-Database-Lizenz, CC-BY-SA
https://www.openstreetmap.org/copyright
http://www.creativecommons.org/
http://www.opendatacommons.org/
Initiative
InitiativeBiodiversität ist kein Selbstläufer
Mit welchen Tricks Sie den heimischen Garten attraktiv für Insekten bepflanzen können, wie schnell ein Nistkasten für Vögel entsteht und warum es mehr Eigeninitiative für die Rettung der Bienen braucht, können Sie auf den nächsten Seiten sehen.
BeedabeiGroße Hilfe für kleine BienenDas Künstlerduo Peter Kalb und Gisela Bartulec setzt sich aktiv für Wildbienen ein. Unter dem Motto "Bienen dabei - sei dabei!" möchten sie alle dazu auffordern, das Gleiche zu tun. Startschuss für dieses spannende Projekt war der 20. Mai 2019. Über 200 gelbe Bienenkästen wurden auf dem Nürnberger Hauptmarkt in ein Kunstwerk verwandelt und im Anschluss an die Bürger verteilt. Mehr dazu gibt es im nächsten Video.
Insektenfreundlicher GartenBlume ist nicht gleich Blume
Mohnbienen widmen sich fast ausschließlich Kornblumen, während die Weidensandbiene Weiden als Pollen – und Nektarquelle vorzieht. Andere Wildbienen fliegen auf Glockenblumen, oder sogar nur auf Efeu.
Typische Pflanzen für Hummeln sind der Fingerhut, die Akelei oder der Eisenhut.
Nistkasten für Wildvögel Unterstützung für Sperling und Co Neben Insekten sind auch Wildvögel auf unsere Hilfe angewiesen. So können Sie mit dem richtigen Futterangebot ihre gefiederten Gartenbewohner sowohl bei der Jungenaufzucht, als auch bei der Nahrungssuche im Winter unterstützen. Heutzutage wird aber nicht nur das natürliche Futterangebot knapp, sondern auch zahlreiche Brutmöglichkeiten. Totholz in lichten Wäldern wird bevorzugt von den Wildvögeln als Nistplatz ausgesucht, doch davon gibt es immer weniger. Helfen Sie mit! Finden Sie auf der nächsten Seite eine Bauanleitung für einen Nistkasten. Dieser ist geeignet für Höhlenbrüter.
Nistkasten für Wildvögel Unterstützung für Sperling und Co Neben Insekten sind auch Wildvögel auf unsere Hilfe angewiesen. So können Sie mit dem richtigen Futterangebot ihre gefiederten Gartenbewohner sowohl bei der Jungenaufzucht, als auch bei der Nahrungssuche im Winter unterstützen. Heutzutage wird aber nicht nur das natürliche Futterangebot knapp, sondern auch zahlreiche Brutmöglichkeiten. Totholz in lichten Wäldern wird bevorzugt von den Wildvögeln als Nistplatz ausgesucht, doch davon gibt es immer weniger. Helfen Sie mit! Finden Sie auf der nächsten Seite eine Bauanleitung für einen Nistkasten. Dieser ist geeignet für Höhlenbrüter.


1. Bodenplatte
2. Seitenteile (2 mal)
3. Rückwand mit Scharnier
4. Vorderwand mit Einflugloch ( Ø 3cm)
5. Deckel mit Scharnier
6. Dübel, Sitzstange, Hammer, Holzleim
Die Holzteile haben unterschiedlich viele Löcher zum Einsetzen der Dübel. Eine genaue Erklärung dafür folgt im nächsten Video.

Lebensräume
LebensräumeDer Natur auf der Spur
Entdecken Sie auf der nächsten Seite fünf verschiedene Lebensräume, welche alle ihren ganz persönlichen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten.
Gründlachtal
Pegnitztal Ost
Kaiserburg
Dutzendteich
Rednitztal
Gründlachtal
GründlachtalÖkologisch orientierte LandwirtschaftIm nördlichsten Teil des Knoblauchlandes befindet sich eine durch saftige Wiesen geprägte Umgebung. Sowohl Landwirte als auch Tiere und Pflanzen profitieren von dieser einzigartigen Auenlandschaft. Seit 2017 legen einige Landwirte sogar Blühflächen auf bestimmten Teilen ihrer Äcker an.
Blühflächen in NeunhofBunte Äcker für die UmweltFranz Ell betreibt zusammen mit seiner Frau Maria eine Staudengärtnerei in Neunhof. Neben dem Job will er auch etwas für die Förderung der Biodiversität tun. Im Interview erzählt er über das Blühstreifenprojekt.
Woher kam die Idee, Blühstreifen anzulegen?
Franz Ell: Es ist so entstanden: Dort, wo die Wasserrohre liegen, war immer eine Brachfläche. Solche Brachflächen sind für den Boden nicht gut. Da habe ich mir überlegt, dass man mit diesen Flächen doch etwas machen könnte. Als der Landschaftspflegeverband darauf aufmerksam wurde, haben wir ein Projekt gestartet und auch andere Landwirte haben sich dazu bereiterklärt, Blühstreifen anzulegen.
Wie viele Bauern beteiligen sich in Neunhof?
Franz Ell: Es machen alle mit. Natürlich hat nicht jeder immer eine Fläche zur Verfügung. Das Entscheidendste an der ganzen Sache ist die Freiwilligkeit der Bauern. Was wir hier in Neunhof erreicht haben, ist unglaublich. Es funktioniert nur durch die Freiwilligkeit und die gute Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband und dem Umweltamt.
Was für eine Saatmischung wird verwendet?
Franz Ell: Für die Saatmischungen kann man Einzelkomponenten bestellen. Manche Landwirte bauen Kraut an, da ist es wichtig, dass in der Saatmischung keine Kreuzblütler sind. Sonst hätten sie im nächsten Jahr Probleme beim Krautanbau. Ich verwende einfach eine insektenfreundliche Mischung.
Machen die Blühflächen zusätzlichen Aufwand?
Franz Ell: Ja, es macht Aufwand und kostet mir sogar richtig Geld. Etwa 20% meiner Flächen sind Blühacker. Erst einmal muss ich die Samen säen und die Beregnungsrohe immer wieder freischneiden, sonst funktionieren sie nicht mehr.
Werden die Flächen von den Tieren angenommen?
Franz Ell: Auf jeden Fall. Wir haben die Feldlerche und den Kiebitz. Das Rebhuhn ist auch auf einem Acker. Außerdem natürlich Finken und Sperlinge, oder auch Feldhasen. Die Flächen sind also nicht nur für Insekten, sondern auch für andere Tiere. Viele sind ohnehin nur hier wegen der Landwirtschaft und den Feldern. Ohne uns wäre hier nur Wald.
Beteiligung der LandwirteBlühflächen im Stadtgebiet

Pegnitztal Ost
Pegnitztal OstZwischen Naturschutz und NaherholungEine erholsame Oase für Mensch und Tier mitten in der Großstadt. Das dies funktionieren kann, beweist das Gebiet Pegnitztal Ost, welches Ende 2018 zum Naturschutzgebiet wurde. Es beeindruckt durch seine vielfältigen Landschaften.
WieseBlütenmeer
Für Tiere sind die Wiesen ein wichtiger Lebensraum. Verschiedene Heuschreckenarten und Schmetterlinge verstecken sich zwischen den Gräsern. Auch das stark gefährdete Braunkehlchen baut sein Nest dort am Boden.
SandmagerrasenÜberleben im Extrem
AuenlandschaftÜberschwemmung und Trockenheit
StreuobstAlles Bio!
HeckeSchutz und Versteck
AltbäumeNatürliche Lebensgemeinschaft
Besonders bedeutsam ist hier der Eremit - ein stark gefährdeter Käfer aus der Familie der Blatthornkäfer. Seinem Namen entsprechend besiedelt er beinahe sein ganzes Leben eine Baumhöhle, bevorzugt in Eichen oder Weiden.
SchilfUnscheinbarer Held
Kaiserburg
KaiserburgÜber den Dächern der StadtNürnbergs Wahrzeichen wird täglich von Touristen besucht. Sie kommen, staunen und gehen. Doch was bleibt, sind die tierischen Bewohner. Die Kaiserburg bietet mit ihren Nischen und Mauern einen idealen Lebensraum für rund 1.300 Arten. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr über eine dieser Arten - äußerst scheue, aber dafür umso schützenswertere Tiere: Die Fledermäuse.
Dutzendteich
DutzendteichMehr als GeschichteSeit Jahrhunderten ist der Dutzendteich mit Blick auf die Kongresshalle ein beliebtes Ausflugsziel in Nürnberg. Begleitet von Flora und Fauna lässt es sich gemütlich um den Teich spazieren. Was viele Besucher jedoch nicht wissen - oft handelt es sich bei den alten Bäumen um Naturdenkmäler.
Rednitztal
RednitztalEin Stück MittelalterDer größte Teil des 370 Hektar umfassenden Rednitztals erstreckt sich zwischen Eibach und Katzwang im Südwesten der Stadt. Charakterisierend für diesen Lebensraum ist die seit Jahrhunderten bestehende Wässerwiesennutzung. Dabei wird Wasser aus der Rednitz mithilfe von Gräben und Holzschützen über die Wiesen im Rednitztal verteilt.
Der WeissstorchHoch hinausNachdem Martin Kittsteiner zum erstem Mal einen Weißstorch im Wiesengrund an der Rednitz sah, fasste er den Entschluss, sich für diese eleganten Vögel einzusetzen. Ein Weißstorchprojekt wurde ins Leben gerufen. Auf der nächsten Seite können Sie über den Erfolg des Projekts hören und darüber, was das Rednitztal als Lebensraum für die Störche so besonders macht.
Bruterfolg
Natürliche Feinde
Lebensraum Rednitztal
Nisthilfen
Horstkämpfe
Die RotkopfschafeErhalt einer seltenen ArtVor einigen Jahren wurden die Letzten ihrer Art vor dem Schlachter gerettet. Bis heute hat sich der Bestand der Rouge du Roussillon in Deutschland wieder etwas erholt. Seit 2012 betreut Heidi Stafflinger ihre eigene kleine Herde bei Gebersdorf. Damit sichert Sie nicht nur den Erhalt dieser alten Schafrasse, sondern fördert auch die Artenvielfalt in der Stadt.
Bündnis für Biodiversität
Das Bündnis für BiodiversitätAkteure für die Vielfalt
Gemeinsam will das Bündnis das Bewusstsein für Biodiversität innerhalb der Bevölkerung stärken. Vier Mitglieder und deren spannende Projekte können Sie auf der nächsten Seite genauer kennenlernen.
Das InsektenReich im MarienbergparkGemeinsam ist besser
Erfahren Sie von Hiltrud Gödelmann, was es bedeutet, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen. Sie war jahrelang Stadträtin und ist mittlerweile persönliche Mitarbeiterin des Umweltreferenten. Dadurch weiß Sie genau, worauf es bei solchen Projekten ankommt.
Naturhistorische GesellschaftArtenschutz aus Leidenschaft
Gehen Sie auf der nächsten Seite selbst auf Entdeckungsreise und klicken Sie sich durch die verschiedenen Tierarten.
Wildbiene
Weiherbiotop
Feuersalamander
Bergmolch
Sumpfschildkröte
Wildpflanzen
Kreuzotter
Hornotter
Kräutergarten
Gelbbauchunke
Äskulapnatter
Perleidechse
Smaragdeidechse
Ringelnatter
Laubfrosch
Zauneidechse
Kreuzkröte
Erdkröte
Würfelnatter
Mauereidechse
Wasserfrosch
Landschildkröte
Mikroskopraum
Aquarien
Landschildkröte
LandschildkröteDie Familie der Landschildkröten lässt sich in drei Arten gliedern: Die Griechische Landschildkröte ist an ihrem gelben Panzer mit größeren Flecken zu erkennen, während die Flecken der Maurischen Landschildkröte deutlich kleiner sind. Die Breitrandschildkröte beeindruckt mit ihrem weiten Panzer, vor allem der hintere Teil ist häufig breit aufgestellt. Keine der drei Arten ist einheimisch. Die Landschildkröten leben vor allem im Süden Europas.
Gelbbauchunke
GelbbauchunkeDie Gelbbauchunke lebt verbreitet in Südeuropa und besidelt dort Gebiete in der Nähe von kleinen Gewässern. Ihren Namen verdankt sie dem gelb gefärbten und mit grauen Flecken gemusterten Bauch. Durch diese unverkennbare Zeichnung lassen sich die Tiere leicht voneinander unterscheiden. Mittlerweile lässt sich der Bestand als stark gefährdet einstufen, da immer mehr natürlicher Lebensraum verloren geht.
Hornotter
HornotterDie kräftige Hornotter lebt vorwiegend in trockenen Gebieten im Südosten Europas. Dort begiebt sie sich in der Dämmerung auf die Jagd und frisst neben Vögeln und Mäusen auch andere Reptilien. Ihr gefährlicher Biss macht die Hornotter zu einer der giftigsten Schlangen in Europa. Ein Angriff kann auch für Menschen lebensbedrohlich sein. Dennoch: Die Hornotter ist streng geschützt, da ihr Bestand stetig schrumpft.
Kreuzkröte
KreuzkröteDie Haut der Kreuzkröte ist trocken und bedeckt mit Warzen. Gelegentlich können diese rot gefärbt sein. Wegen ihrer kurzen Hinterbeine kann man Kreuzkröten nur selten beim Hüpfen beobachten - die Tiere krabbeln vorwiegend über den Boden. Tagsüber verstecken sich die Kröten in Höhlen oder Sand, bevor sie in der Nacht aktiv werden und auf Nahrungssuche gehen. Ihre Ernährung besteht aus Schnecken, Spinnen und kleinen Insekten.
Wasserfrosch
WasserfroschWasserfrösche sind anspruchslos in ihrer Lebensweise. Sie halten sich in Weihern und Teichen in ganz Europa auf, können das Wasser aber auch verlassen. Zu ihrer Nahrung gehören Insekten, Würmer, Amphibien oder sogar Kaulquappen der eigenen Art. Während der Paarungszeit nutzen Männchen ihre Schallblasen, um Weibchen anzulocken. Ein Wasserfroch legt bis zu 5.000 Eier.
Wildbiene
WildbieneDas Freiland- Aquarium und -Terrarium bietet Informationen über Wildbienen. Anders als Honigbienen leben die sogennanten "Solitärbienen" einzeln und sind dadurch oft auf Insektenhotels angewiesen, um ihre Eier nacheinander in den kleinen Gängen abzulegen. Die Weibchen versorgen die Eier mit Nektar, bevor die Zellen verschlossen werden. Geschlüpfte Larven fressen diesen Vorrat und verpuppen sich anschließend, um im folgenden Fühjahr zu schlüpfen.
Kreuzotter
KreuzotterDie Kreuzotter gehört zu der Familie der Vipern. Die schlanke, grau bis schwarz gefärbte Schlange ist vor allem durch ihre ovalen Pupillen zu erkennen. Ihr Gift ist für kleine Beute wie Eidechsen und Frösche tödlich, es hat außerdem eine vorverdauende Wirkung. Bei Menschen sind tödliche Bisse hingegen äußerst selten. Die Kreuzotter verwendet bei reiner Abwehr kein oder nur wenig Gift.
Erdkröte
ErdkröteDie Erdkröte ist nachtaktiv. Durch Berührung sondert sie ein Gift aus, welches zu leichten Reizungen führen kann. Früher wurde das Sekret der Erdkröte sogar als Heilmittel verwendet. Bei der Fortpflanzung klettert das Männchen auf den Rücken des Weibchens und verhaart in dieser Position bis zur Eiablage, um diese zu befruchten. Aus den Eiern entwickeln sich nach ein paar Tagen Kaulquappen, welche widerrum in etwa 3 Monaten zu einer Erdkröte heranwachsen.
Ringelnatter
RingelnatterRingelnattern sind in ganz Europa zu finden, wo sie Sümpfe, Teiche und Feuchtwiesen besiedeln. Ihre Ernährung besteht aus Amphibien und Fischen. Die schlanke Natter ist während der Jagd jedoch deutlich ungeschickter als die Würfelnatter und fängt nur selten Fische. Ihr Bestand geht stetig zurück. In Deutschland steht sie unter Schutz und darf niemals gestört oder getötet werden.
Sumpfschildkröte
SumpfschildkröteDie Sumpfschildkröte ist eine der am meisten gefährdeten Wirbeltierarten Deutschlands - sie ist mittlerweile vom Aussterben bedroht, da ihr natürlicher Lebensraum zunehmend trockengelegt wird. Die geschickte Schwimmerin geht im Wasser auf die Jagd nach Kaulquappen, kleinen Fischen oder Würmern. Ihr Panzer ist weitaus instabiler als die schützende Hülle der Landschildkröte. Sumpfschildkröten können sogar Berührungen dort wahrnehmen. Dies haben sie einer Art lebenden Haut direkt unter dem Panzer zu verdanken.
Wildpflanzen
WildpflanzenEine große Blütenpracht schmückt das Freilandterrarium. Die Auswahl an Wildpflanzen gibt einen Einblick in die Vielfalt der heimischen Flora, welche sowohl als Blickfang als auch als Lebensgrundlage vieler Tiere fungiert. Vögel, Insekten und Kleinsäuger werden durch die Wildpflanzen angelockt und finden Nahrung.
Würfelnatter
WürfelnatterEntgegen einer Länge von bis zu 130cm und einer aufregenden Zeichnung lebt die Würfelnatter friedlich an Ufern von Flüssen und Seen. Dort findet die gut ausgebildete Schwimmerin Fische, Frösche und Kaulquappen als Nahrung. Mittlerweile ist ihr Bestand stark bedroht. Immer mehr Ufer werden umgebaut und somit als Lebensraum ungeeignet.
Smaragdeidechse
SmaragdeidechseDie wechselarmen Echsen gönnen sich meist morgens und abends lange Sonnenbäder, um ihre Temperatur zu regulieren. Doch schon bei kleinster Gefahr verstecken sich die scheuen Tiere schnell zwischen Gräsern oder in Höhlen. Dabei fällt vor allem ihr ungewöhnlicher Laufstil auf: Smaragdeidechsen bewegen gleichzeitig das rechte Vorderbein und das linke Hinterbein nach vorne.
Kräutergarten
KräutergartenKamille, Lavendel, Kümmel oder Rosmarin - Kräuter sind schon seit Jahrhunderten aus keiner Küche wegzudenken. Ob als Heil - oder Gewürzkräuter, jede kleine Pflanze hat ihre ganz eigene Superkraft. In voller Blüte ernähren Gewürzfenchel und Co auch Insekten.
Weiherbiotop
WeiherbiotopAuf den ersten Blick unscheinbar, doch bei genauerem Hinsehen entfaltet sich die Vielfalt des Lebens an Weihern und künstlich angelegten Teichen. Fische, Amphibien, Insekten und Schlangen bewohnen die Gewässer und finden in den umliegenden Pflanzen Schutz und Nahrung. Auch Wasserläufer und Libellen sind mit etwas Geduld zu erkennen.
Mauereidechse
MauereidechseDie flinke Kletterin bewohnt vorwiegend sonnige, warme Felswände und Mauern. Dort ernährt sie sich von Insekten und Spinnen. Bei einem Angriff kann die Mauereidechse ihren Schwanz abwerfen. Das Kuriose: Der abgetrennte Schwanz bewegt sich noch minutenlang weiter, um den Feind abzulenken. Nach wenigen Monaten sieht die Mauereidechse wieder aus wie vorher, ihr Schwanz wächst nach.
Perleidechse
PerleidechseMit einer Länge von 80 cm sind Perleidechsen die größten Eidechsen in Europa. Sie gelten nicht als gefährdet, stehen aber dennoch unter Schutz. Ihrem Namen entsprechend schmücken sich die kräftigen Reptilien mit ihren perlförmigen, blauen Schuppen an beiden Seiten. Bei einem Angriff durch Hunde oder andere Tiere verteidigen sich Perleidechsen durch Fauchen und Bisse.
Laubfrosch
LaubfroschHoch oben auf Blättern und Sträuchern macht es sich der Laubfrosch gemütlich. Durch Haftballen an Fingern und Zehen gelingt es ihm mühelos, selbst glatte Oberflächen wie Glasscheiben zu erklimmen. Am Ziel angekommen, ziehen die 3-5 cm großen Lurche ihre Gliedmaßen während eines Sonnenbads dicht an den Körper, um kein Wasser zu verlieren. In Deutschland ist der Laubfrosch durch den Einsatz von Pestiziden und die Zerstörung seines natürlichen Lebensraums fast ausgestorben.
Feuersalamander
FeuersalamanderDas auffällige Muster aus schwarz und gelb dient dem Feuersalamander als Warntracht. Funktioniert die Abwehrmethode nicht, wehrt er sich gegen Feinde durch Giftdrüsen hinter den Augen und am Rücken. Für Menschen ist das Sekret jedoch ungefährlich. Ohnehin genießt der Feuersalamander in Deutschland besonderen Schutz, seine Höhlen in Wäldern werden bewusst erhalten. Dank dieser Schutzmaßnahmen können die Salamander in freier Wildbahn über 20 Jahre alt werden.
Aquarien
AquarienIn gleich mehreren Aquarien können heimische Fische, Krebse und Molche bewundert werden. Besucher können sich über die verschiedenen Wasserbewohner informieren, so beispielsweise über den Sterlet. Hätten Sie es gewusst? Mit den Barteln an der Schnauze kann der Sterlet seine Umbegung ertasten und auch erschmecken. Er nutzt sie vorwiegend bei der Nahrungssuche.
Äskulapnatter
ÄskulapnatterSchon gewusst? Der Name der Äskulapnatter lässt sich auf den antiken Gott „Asklepios“ zurückführen. Er wurde als Gott der Heilkunde verehrt. Die Schlange ist heute auf dem Symbol von Apotheken zu erkennen. In freier Wildbahn ist die Äskulapnatter harmlos und ihr Bestand gilt als ungefährdet. Sie ist durch ihre glatte, gelb bis schwarze Oberfläche erkennbar.
Zauneidechse
ZauneidechseAnders als die Mauereidechse weisen Zauneidechsen einen recht kurzen Schwanz und kleinen Kopf auf. Eine markante Zeichnung am Rücken ist charakteristisch für Zauneidechsen. Während der Paarungszeit sind die Männchen grün gefärbt, die Weibchen dagegen behalten ganzjährig eine bräunliche Oberfläche.
Bergmolch
BergmolchKlein und wendig durchquert der Bergmolch neben Gewässern auch Landschaften mit Zugang zu Tümpeln und Seen. Vor allem während der Paarungszeit hält er sich in Wassernähe auf, danach kann er zwischenzeitlich auch an Land leben. In Deutschland ist sein Verbreitungsgebiet vor allem im Süden. Im Norden gibt es kaum Funde von Bermolchen.
Mikroskopraum
MikroskopraumUnter verschiedenen Mikroskopen lassen sich Schmetterlinge, Käfer und sogar Krebse ganz genau untersuchen. Der Panzer einer Schildkröte wird erklärt, die Arbeitsweise von Blattläusen oder die Haut vom Steinkrebs. Hier heißt es: Genau hinschauen!
Bund NaturschutzNaturschützer von morgen
Die Kindergruppe Gostenhof nimmt Sie auf der nächsten Seite auf eine Reise zum Valznerweiher im Osten Nürnbergs mit. Lernen Sie von den Kindern, warum sich ein Ausflug in die Natur lohnt.
BluepinguBiodiversität auf kleinster Fläche
Xenia Mohr arbeitet ehrenamtlich im Stadtgarten. Im folgenden Video erzählt sie über die Grundidee des Stadtgartens, das Besondere an dem Konzept und ihre Zukunftswünsche.
Landesbund für VogelschutzPionierarbeit
Lernen Sie in einer kleinen Fotostrecke mehr über die spannenden Landschaften.
Herausforderungen
HerausforderungenGrün, grüner... Nürnberg?
Wie Biodiversität in Nürnberg bewahrt werden kann, warum die Großstadt im Vergleich zum Rest Deutschlands noch grüner werden muss und wie massiv das Insektensterben wirklich ist, können Sie in diesem Kapitel nachlesen.
Gespräch mit Dr. Peter PluschkeWie funkioniert Biodiversität in einer Großstadt?Dr. Peter Pluschke ist seit 2008 Umweltreferent der Stadt Nürnberg. Im Interview spricht er offen über die Probleme beim Erhalt der biologischen Vielfalt, aber auch darüber, was die Stadt schützenswert und besonders macht.
Herr Dr. Peter Pluschke, in Nürnberg hat man immer das Gefühl, dass überall gebaut und neuer Wohnraum geschaffen wird. Wie schwierig ist es da, einen Ausgleich zu schaffen?
Dr. Peter Pluschke: Es ist es extrem schwierig. Den flächenmäßigen Ausgleich nach Naturschutzrecht und den artenschutzrechtlich geforderten Ausgleich schaffen wir nicht mehr komplett. Vor allem, wenn man auch noch Ausgleichserfordernisse nach Waldgesetz dazu nimmt. Das sind drei verschiedene Rechtssysteme, in denen wir ausgleichspflichtig sind.
Wie geht es der Biodiversität in Nürnberg?
Dr. Peter Pluschke: Ich nenne immer gerne die Kaiserburg. Wir haben dort mit 1.300 Arten einen enormen Reichtum an Biodiversität. Mit den Fledermäusen haben wir einen Schatz. Dort sind die Räumlichkeiten für Fledermäuse gegeben, wo sie auch überwintern können. Wichtig sind für mich auch die Höhlenbrüter, von denen ja auch viele an Baulichkeiten gebunden sind, um Unterschlupf zu finden. Alle assoziieren mit Biodiversität immer erst mal grüne Bäume und grüne Flächen, aber es gibt sie auch im baulichen Bereich. Wichtig ist, dass man die Stadt auch als belebt wahrnimmt, wo sie steinern ist.
Welche Bedeutung haben andere Lebensräume, abgesehen von der Burg, für den Erhalt der Artenvielfalt?
Dr. Peter Pluschke: Es gibt größere Ökosystemflächen wie das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost, der Föhrenbuck mit Sandlebensräumen, der Hainberg, die Ziegelach am Flughafen oder der Raum um den Bucher Landgraben. Dort wurde unter Einsatz naturschutzrechtlicher Möglichkeiten Aufenthaltsqualität für eine Menge Tiere und Arten geschaffen.
Wie werden diese Lebensräume von den Bürgern angenommen?
Dr. Peter Pluschke: Beim Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost gab eine Fraktion, die sagte „Ihr habt da ein Landschaftsschutzgebiet und das reicht“. Viele kamen wegen den Einschränkungen für die Hundehaltung, obwohl die Betretungsverbote von Agrarflächen schon vor Ausrufung des Naturschutzgebiets da waren. Jeder Hundehalter empfindet sich als Naturfreund. Weil der Hund für ihn das Symbol dafür ist, dass er gut und liebevoll mit der Natur umgeht. Und wenn sein Hund sich dann frei bewegt, hat dieser vermeintlich ein Recht darauf, weil er sich im Einklang mit der Natur befindet. Aber die Hunde in der freien Natur sind wegen der Bodenbrüter und der Risiken für die Grundwasser - und Futtermittelgewinnung eigentlich das größte Problem für uns. Und das wird nicht gern akzeptiert.
Inwiefern können Sie die Akzeptanz steigern?
Dr. Peter Pluschke: Bei dem Reden über Biodiversität gibt es neben der fachlichen Dimension immer auch eine Herzensdimension. Man braucht symbolhafte Pflanzen und Tiere, um unseren Bürgern nahezubringen, wie Schutzwürdigkeit entsteht. Blaukehlchen haben nicht mehr viele Reviere und wir hoffen, dass sie um den Bucher Landgraben immer wieder kommen. Aber wen wir in Nürnberg inzwischen häufig sehen können ist der Eisvogel. Er ist eigentlich nicht so selten, aber natürlich für einen Städter als Erscheinung schon was ganz Besonderes.
Gibt es Arten, auf deren Förderung Sie besonders stolz sind?
Dr. Peter Pluschke: Wir sind ganz stolz auf die Kiebitze im Knoblauchsland. Sie machen uns unglaublich viel Aufwand. Wir wollen natürlich diese schöne Population erhalten und müssen dann sehr große Flächen bei Eingriffen in deren Sieglungsgebiet neu identifizieren, um sie ihnen anbieten zu können. Bisher haben wir es immer geschafft. Wir sind auch auf die Störche stolz. Es gab einmal ein Bild, da waren nahezu 100 Störche vor dem Zug im Rednitzgrund versammelt. Das zeigt, dass der Bereich der Rednitz sehr gut für die Störche ist, sonst würden sie sich da nicht sammeln.
Gibt es auch Problemfälle?
Dr. Peter Pluschke: Ja, der Biber. Es fällt auf, dass er hier im Innenstadtbereich Bäume umlegt. Wir betreiben Baumschutz gegen den Biber und kommen mit seiner immer weitergehenden Ausbreitung auch an Stellen, wo er die Landwirtschaft und den Verkehr beeinträchtigt. Es gab durch seine Dammbauten Überflutungen von Straßen und Ackerland und da ist der Konflikt so evident, dass auch die Entnahme von Bibern ein Thema ist.
Was unterscheidet Nürnberg von anderen Städten im Hinblick auf Biodiversität?
Dr. Peter Pluschke: Biodiversität hat immer eine sehr lokale Ausprägung. Aber etwas, was wir auf der Burg haben, würde ich schon unter den Begriff „einzigartig“ fassen – ohne, dass ich das „einzigartig“ zu weit raushängen will. Das zieht immer einen Biodiversitätstourismus nach sich, der eher gefährlich ist. Insofern möchte ich Biodiversität nicht als Attraktion vermarkten, sondern eher als stillen Schatz. Diejenigen, die nach so etwas suchen, werden es finden.
Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?
Dr. Peter Pluschke: Wir sind im Augenblick dabei, ein neuartiges Ausgleichsmanagement zu entwickeln. Doch es gibt in einer Großstadt keinen härteren Konflikt als den um Fläche. Und wenn Sie grüne Flächen haben, werden sie permanent unter Druck gesetzt, diese herzugeben. Deswegen ist das etwas, wo ich noch nicht sage kann: Wir sind soweit. Aber wir werden uns dahin bewegen, das Zusammenbinden von Biodiversitätsinteressen und Flächenbesitz voranzubringen. Das ist die schwierigste Aufgabe.
Biodiversität in EuropaLandschaftsschutzgebiete im Vergleich

Deutschland liegt dabei auf Rang vier.
Deutschland grünt

Nicht einmal die Hälfte der Fläche Nürnbergs ist demnach grün, obwohl Grünflächen eine wichtige Voraussetzung für Biodiversität sind.
Gespräch über Insektensterben"Den Menschen ist moralisch die Brisanz bewusst, aber ihnen fehlt die Liebe."Wolfgang Dötsch ist Diplom-Biologe und Geschäftsführer der Nürnberger Kreisgruppe des Bundnaturschutz. Am Rande eines Heuschreckenseminars spricht er über das Insektensterben in der Region und erzählt, was er sich von den Bürgern wünschen würde.
Herr Dötsch, welche sind die Hauptgründe für den massiven Insektenrückgang?
Wolfgang Dötsch: Es ist auf der einen Seite die Landwirtschaft mit der Bodenbelastung durch die Großmaschinen. Die modernen Kreiselmähwerke häckseln durch den Sog alles klein. Selbst das, was sie nicht treffen, wird durch den enormen Luftzug getroffen. Man darf auch die Forstwirtschaft nicht auslassen. Es gibt dort ein starkes Rollback. Man muss ganz offen sagen, dass die Zeit des naturnahen Waldumbaus weitgehend schon vor 15 bis 20 Jahren abgeschlossen war. Wenn man die Förster fragt, sagen sie immer, sie brauchen für ihren wirtschaftlichen Gewinn keine artenreichen Laubmischwälder. Diese Hölzer können sie nicht vermarkten.
Wie lässt sich die Entwicklung des Insektensterbens einschätzen?
Wolfgang Dötsch: Das, was wir als Datengrundlage zitieren, beschreibt nur einen kleinen Teil der Katastrophe. Man muss davon ausgehen, dass der Großteil des Schwunds vor den Untersuchungen passiert ist, vermutlich mit Beginn der industriellen Landwirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg. Wenn wir also ab 1990 untersuchen, fehlen uns mindestens zwei bis drei Jahrzehnte. Wir merken es an Insekten wie dem Maikäfer, der früher selbstverständlich war. Das waren Massentiere, die haben ganze Wälder und Obstbäume abgefressen, abgeleert, und irgendwann so in den 60ern war schlagartig Schluss.
Welche Bedeutung hat die Stadt Nürnberg als Lebensraum für Bienen?
Wolfgang Dötsch: Für Nürnberg kann man grundsätzlich sagen, dass die Stadt eine enorme Bedeutung als Bienenlebensraum hat. Wir sind einer der bayernweiten Spitzenreiter. Das liegt zum einen an unserem Klima, das trocken und relativ warm ist. Und zweitens liegt es auch an den Böden, die hier in Nürnberg überwiegend sandig sind. Man muss bedenken, dass unsere Wildbienen wie auch die Honigbienen in ihrer Lebensweise auf Wärme angewiesen sind. Bei Dauerregen und Kälte fliegen sie nicht.










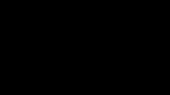



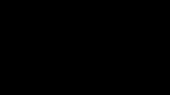




























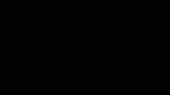




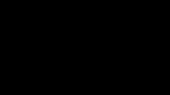































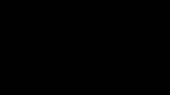

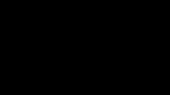










 Belebte Großstadt
Belebte Großstadt
 Übersicht
Übersicht
 Impressum
Impressum
 Biodiversität ist kein Selbstläufer
Biodiversität ist kein Selbstläufer
 Große Hilfe für kleine Bienen
Große Hilfe für kleine Bienen
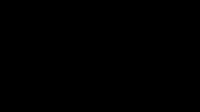 Videobeitrag Beedabei
Videobeitrag Beedabei
 Blume ist nicht gleich Blume
Blume ist nicht gleich Blume
 Insektenhotel
Insektenhotel
 Unterstützung für Sperling und Co
Unterstützung für Sperling und Co
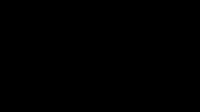 Videoanleitung Nistkasten bauen
Videoanleitung Nistkasten bauen
 Der Natur auf der Spur
Der Natur auf der Spur
 Auswahl Lebensräume
Auswahl Lebensräume
 Ökologisch orientierte Landwirtschaft
Ökologisch orientierte Landwirtschaft
 Bunte Äcker für die Umwelt
Bunte Äcker für die Umwelt
 Blühstreifen im Wachstum
Blühstreifen im Wachstum
 Blühflächen im Stadtgebiet
Blühflächen im Stadtgebiet
 Zwischen Naturschutz und Naherholung
Zwischen Naturschutz und Naherholung
 Landschaften Auswahlseite
Landschaften Auswahlseite
 Blütenmeer
Blütenmeer
 Schafe
Schafe
 Überleben im Extrem
Überleben im Extrem
 Sandgrasnelke
Sandgrasnelke
 Überschwemmung und Trockenheit
Überschwemmung und Trockenheit
 Bewohner der Auenlandschaft
Bewohner der Auenlandschaft
 Alles Bio!
Alles Bio!
 Vorteile der Streuobstwiese
Vorteile der Streuobstwiese
 Schutz und Versteck
Schutz und Versteck
 Natürliche Lebensgemeinschaft
Natürliche Lebensgemeinschaft
 Baumhöhlen
Baumhöhlen
 Unscheinbarer Held
Unscheinbarer Held
 Über den Dächern der Stadt
Über den Dächern der Stadt
 Zweifarbfledermaus
Zweifarbfledermaus
 Braunes Langohr
Braunes Langohr
 Rauhautfledermaus
Rauhautfledermaus
 Bartfledermaus
Bartfledermaus
 Mehr Vielfalt?
Mehr Vielfalt?
 Mehr als Geschichte
Mehr als Geschichte
 Methusalembäume
Methusalembäume
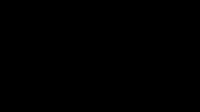 Dutzendteich Impressionen
Dutzendteich Impressionen
 Ein Stück Mittelalter
Ein Stück Mittelalter
 Hoch hinaus
Hoch hinaus
 Storch-Audio
Storch-Audio
 Erhalt einer seltenen Art
Erhalt einer seltenen Art
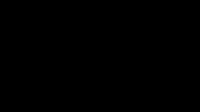 Rotkopfschafe Video
Rotkopfschafe Video
 Akteure für die Vielfalt
Akteure für die Vielfalt
 Akteure Auswahlseite
Akteure Auswahlseite
 Gemeinsam ist besser
Gemeinsam ist besser
 InsektenReich Audio
InsektenReich Audio
 Artenschutz aus Leidenschaft
Artenschutz aus Leidenschaft
 Freilandaquarium - und terrarium
Freilandaquarium - und terrarium
 Landschildkröte
Landschildkröte
 Gelbbauchunke
Gelbbauchunke
 Hornotter
Hornotter
 Kreuzkröte
Kreuzkröte
 Wasserfrosch
Wasserfrosch
 Wildbiene
Wildbiene
 Kreuzotter
Kreuzotter
 Erdkröte
Erdkröte
 Ringelnatter
Ringelnatter
 Sumpfschildkröte
Sumpfschildkröte
 Wildpflanzen
Wildpflanzen
 Würfelnatter
Würfelnatter
 Smaragdeidechse
Smaragdeidechse
 Kräutergarten
Kräutergarten
 Weiherbiotop
Weiherbiotop
 Mauereidechse
Mauereidechse
 Perleidechse
Perleidechse
 Laubfrosch
Laubfrosch
 Feuersalamander
Feuersalamander
 Aquarien
Aquarien
 Äskulapnatter
Äskulapnatter
 Zauneidechse
Zauneidechse
 Bergmolch
Bergmolch
 Mikroskopraum
Mikroskopraum
 Naturschützer von morgen
Naturschützer von morgen
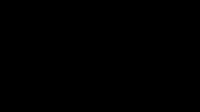 Videobeitrag Kindergruppe Gostenhof
Videobeitrag Kindergruppe Gostenhof
 Biodiversität auf kleinster Fläche
Biodiversität auf kleinster Fläche
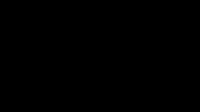 Videobeitrag Stadtgarten
Videobeitrag Stadtgarten
 Pionierarbeit
Pionierarbeit
 Sandlebensraum
Sandlebensraum
 Buntes Treiben
Buntes Treiben
 Kieferbestand
Kieferbestand
 Tümpel
Tümpel
 Grün, grüner... Nürnberg?
Grün, grüner... Nürnberg?
 Wie funkioniert Biodiversität in einer Großstadt?
Wie funkioniert Biodiversität in einer Großstadt?
 Landschaftsschutzgebiete im Vergleich
Landschaftsschutzgebiete im Vergleich
 "Den Menschen ist moralisch die Brisanz bewusst, aber ihnen fehlt die Liebe."
"Den Menschen ist moralisch die Brisanz bewusst, aber ihnen fehlt die Liebe."
 Interview Wolfgang Dötsch Teil 2
Interview Wolfgang Dötsch Teil 2