Hauptstrang
Erinnerungskultur in Nürnberg und AnsbachWie lebt die NS-Geschichte weiter?
2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Nur noch wenige überlebende Zeitzeuginnen und Zeitzeugen können heute von den Gräueltaten der Nationalsozialisten berichten. In Städten wie Nürnberg und Ansbach zeigt sich, dass ihre Geschichten nicht verloren gehen. Grund dafür ist eine lebendige Gedenkkultur.
Danksagung
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Personen, die unser Projekt ermöglicht haben. Ein besonderer Dank gilt:
Dr. Pascal Metzger
PD Dr. Immanuel Baumann
Dr. Martina Christmeier
Gunter Demnig
Katja Demnig
Michael Meyer
Stadtarchiv Ansbach
Synagoge Ansbach
Dr. Pascal Metzger
PD Dr. Immanuel Baumann
Dr. Martina Christmeier
Gunter Demnig
Katja Demnig
Michael Meyer
Stadtarchiv Ansbach
Synagoge Ansbach
Credits
Michael Meyer
Stadtarchiv Ansbach
Synagoge Ansbach
Stadtarchiv Ansbach
Synagoge Ansbach
Impressum
Annika Haas
Oberdorfstraße 72, 76698 Ubstadt-Weiher
haas20862@hs-ansbach.de
Kim Heuck
Sophienstraße 16, 90478 Nürnberg
heuck21811@hs-ansbach.de
Verantwortliche im Sinne des §55 Abs.
2 Rundfunkstaatsvertrag
Ein Projekt der Hochschule Ansbach, Studiengang Ressortjournalismus (Fach "Projekt Crossmedia") und https://www.flz.de, das Online-Portal der Fränkischen Landeszeitung
Oberdorfstraße 72, 76698 Ubstadt-Weiher
haas20862@hs-ansbach.de
Kim Heuck
Sophienstraße 16, 90478 Nürnberg
heuck21811@hs-ansbach.de
Verantwortliche im Sinne des §55 Abs.
2 Rundfunkstaatsvertrag
Ein Projekt der Hochschule Ansbach, Studiengang Ressortjournalismus (Fach "Projekt Crossmedia") und https://www.flz.de, das Online-Portal der Fränkischen Landeszeitung
Gunter Demnig
Gunter DemnigKopf hinter den „Stolpersteinen“ und der Initiative „Spuren“
Gunter Demnig ist ein deutscher Künstler, der mit seinem Kunst- und Erinnerungs-Projekt „Stolpersteine“ seit gut 30 Jahren ein Zeichen gegen das Vergessen setzt. Seit den 1990er Jahren verlegt er kleine Messingtafeln im Gehweg vor den letzten frei gewählten Wohnorten von NS-Opfern mit der Inschrift: „Hier wohnte“ gefolgt von Namen, Geburtsdaten sowie Informationen über das Schicksal der Person mit der jeweiligen NS-Bezeichnung. Zu den Opfern der Nazis gehörten Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Homosexuelle und andere marginalisierte Gruppen.
Mit seinen dezentralen Denkmälern bringt Demnig die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus zurück in den Alltag der Städte und Gemeinden, direkt vor die Haustüren. Sein Werk ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Kunst und Zivilgesellschaft zur aktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit beitragen können.
Mit seinen dezentralen Denkmälern bringt Demnig die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus zurück in den Alltag der Städte und Gemeinden, direkt vor die Haustüren. Sein Werk ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Kunst und Zivilgesellschaft zur aktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit beitragen können.
Stolperstein-Verlegung
Stolpersteine erzählen Geschichten und ihre Anordnung erzählt mit. Die Steine für Ehepartner werden nebeneinander verlegt, um ihre persönliche Verbindung zu verdeutlichen. Bei Familien, die über mehrere Generationen hinweg vom NS-Terror betroffen waren, erfolgt die Anordnung übereinander, als Zeichen ihrer familiären Zusammengehörigkeit. Zusätzlich wird innerhalb von Gruppen oder Familien häufig eine alphabetische Ordnung der Namen gewählt.
Auch praktische Aspekte wie Pflasterart, Gehwegbreite oder Platzverhältnisse beeinflussen die genaue Anordnung vor Ort. So wird mit jeder Verlegung nicht nur individuelles Gedenken ermöglicht, sondern auch ein sensibler Umgang mit Raum, Geschichte und Erinnerung gelebt. Diese Verlegung ist zugleich ein Abschluss. Alle bekannten Schicksale in Ansbach wurden aufgearbeitet. Vorerst ist dies die letzte Stolperstein-Verlegung in der Stadt gewesen. Seit 2019 wurden in Ansbach insgesamt 138 dieser Steine verlegt.
Auch praktische Aspekte wie Pflasterart, Gehwegbreite oder Platzverhältnisse beeinflussen die genaue Anordnung vor Ort. So wird mit jeder Verlegung nicht nur individuelles Gedenken ermöglicht, sondern auch ein sensibler Umgang mit Raum, Geschichte und Erinnerung gelebt. Diese Verlegung ist zugleich ein Abschluss. Alle bekannten Schicksale in Ansbach wurden aufgearbeitet. Vorerst ist dies die letzte Stolperstein-Verlegung in der Stadt gewesen. Seit 2019 wurden in Ansbach insgesamt 138 dieser Steine verlegt.
Wir haben mit dem Künstler ein längeres Gespräch geführt. Wenn Sie mehr Infos zu ihm und seiner Arbeit mit der Erinnerungskultur erhalten wollen, lesen Sie das vollständige Interview, welches im nächsten Abschnitt folgt. Interview Gunter Demnig
Wir haben mit dem Künstler ein längeres Gespräch geführt. Wenn Sie mehr Infos zu ihm und seiner Arbeit mit der Erinnerungskultur erhalten wollen, lesen Sie das vollständige Interview, welches im nächsten Abschnitt folgt. Interview Gunter Demnig
Vollbild
Was bedeutet „Erinnerungskultur“ für Sie persönlich?
Für mich ist wichtig, die „Erinnerungskultur“ an Schülerinnen und Schüler sowie an Jugendliche weiterzugeben. Ich wurde von Lehrern gewarnt, die mir gesagt haben „Dieses Thema, bloß nicht. Steht den bis hier, kommt den zu den Ohren raus“. Ich habe das Gegenteil erfahren. Wenn die Schülerinnen und Schüler ein Buch aufschlagen und lesen „Sechs Millionen ermordete Juden“ können sie sich das nicht vorstellen. Und da kommen ja noch mal acht Millionen Menschen dazu, die von den Nazis aus anderen Gründen ermordet wurden. Das ist eine abstrakte Größe, auch für mich. Über die Arbeit mit den individuellen Schicksalen merken sie dann aber, dass das nicht irgendwo weit weg stattgefunden hat, sondern bei ihnen um die Ecke. Es ist einfach ein anderer Geschichtsunterricht. Ich halte das Zusammentreffen von Schülerinnen und Schülern mit den Angehörigen im Rahmen des Projekts für einen ganz wertvollen pädagogischen Aspekt.
Erinnern Sie sich noch an den Moment, indem sie gemerkt haben, dass aus Ihrem Kunstprojekt etwas viel Größeres wird?
Für mich als Künstler waren die Stolpersteine anfangs einfach ein konzeptuelles Kunstwerk. Ich habe angesichts der Zahl überhaupt nicht daran geglaubt, es wirklich zu realisieren. Aber im Leben gibt es keine Zufälle, wirklich nicht. Fast gleichzeitig hatte Karlheinz Schmid, der die „Kunstzeitung“ herausgibt, damals noch in Regensburg, jetzt in Berlin, ein Buchprojekt. Kunstprojekte für Europa mit dem Titel „Größenwahn“. Und ich dachte mir „Größenwahn, das passt perfekt“. Also fertigte ich den ersten „Stolperstein“ an und er druckte ihn in seinem Buch ab. Das hat dann wiederum der Pfarrer aus meiner Gemeinde in die Hände bekommen. Er meinte daraufhin zu mir „Naja, Gunter, die Million wirst du nicht schaffen.“ Aber man kann ja klein anfangen. Stand jetzt bin ich bei 117.000 Steinen. Im Vergleich zu einer Million sind 170.000 natürlich nur ein Bruchteil. Die Symbolwirkung dieser Steine ist allerdings viel größer.
Wie lässt sich die Freude über neue Erinnerungsorte mit dem Leid der Vergangenheit vereinbaren?
Der Hintergrund des Projektes ist ja eigentlich kein Grund zur Freude. Ich kann trotzdem auch im Namen meiner Mitarbeiter sagen „Wir freuen uns über jeden Ort, der dazu kommt. Jedes Land und jeden einzelnen Stein“. Es ist schön, dass durch das Projekt immer noch eine Aufarbeitung der Vergangenheit stattfindet. Also gerade bei Behinderten-Morden: Die Enkel, die plötzlich fragen „Warum hatten wir nie eine Oma?“. Durch dieses Nachfragen kommt heraus, was damals passiert ist.
Wie gehen Sie bei fehlerhaften und entwendeten Steinen vor?
Die Inschriften auf den Steinen sind zu 99 Prozent korrekt, Fehler passieren trotzdem. Es ist schon mal vorgekommen, obwohl der Stein durch vier Korrekturen gelaufen ist, dass mich ein Mitarbeiter aus Berlin angerufen hat und meinte „Sag mal, Jahrgang 1819, kann das stimmen?“. Solche Fehler werden so schnell wie möglich ausgebessert und gestohlene Steine genauso schnell ersetzt. Bei entwendeten Steinen durch Vandalismus setzt sonst oft der „Nacharmer-Effekt“ ein und es würden dann noch mehr Steine fehlen. In solchen Fällen muss so rasch und so still wie möglich vorgegangen werden.
Wie soll das Projekt weitergeführt werden, wenn Sie die Arbeit nicht mehr selber machen können?
Erstens kann ich mir durchaus einen Fahrer leisten und beim Verlegen zugucken und Anweisungen geben. Zweitens hat mich eine Hessin gekapert und geheiratet. Sie ist 28 Jahre jünger und kann schon Stolpersteine verlegen. Sie war bereits in Deutschland, Österreich, in Lichtenstein und in der Schweiz unterwegs. Ich kriege dann immer nur zu hören „Aber der Gunter macht das viel schneller.“ Das stimmt, aber ich habe ja auch mehr als 100.000 Steine Vorsprung. Von den 117.000 verlegten Steinen habe ich in etwa 90 Prozent selber verlegt, aber inzwischen brauche ich Hilfe. Im Jahr 2019 war ich 270 Tage von zu Hause weg und irgendwann hat mein geliebtes Eheweib Katja gesagt „Ne, weniger“. Wenn ich bereits an dem jeweiligen Verlegungsort war, übernimmt der Bauhof meine Arbeit. Eine Erstverlegung mache ich aber immer noch selber, um den Leuten zu zeigen, wie man die Steine richtig verlegt. Ich sehe da also überhaupt kein Problem. Wir sind in der Stiftung gut aufgestellt.
Für mich ist wichtig, die „Erinnerungskultur“ an Schülerinnen und Schüler sowie an Jugendliche weiterzugeben. Ich wurde von Lehrern gewarnt, die mir gesagt haben „Dieses Thema, bloß nicht. Steht den bis hier, kommt den zu den Ohren raus“. Ich habe das Gegenteil erfahren. Wenn die Schülerinnen und Schüler ein Buch aufschlagen und lesen „Sechs Millionen ermordete Juden“ können sie sich das nicht vorstellen. Und da kommen ja noch mal acht Millionen Menschen dazu, die von den Nazis aus anderen Gründen ermordet wurden. Das ist eine abstrakte Größe, auch für mich. Über die Arbeit mit den individuellen Schicksalen merken sie dann aber, dass das nicht irgendwo weit weg stattgefunden hat, sondern bei ihnen um die Ecke. Es ist einfach ein anderer Geschichtsunterricht. Ich halte das Zusammentreffen von Schülerinnen und Schülern mit den Angehörigen im Rahmen des Projekts für einen ganz wertvollen pädagogischen Aspekt.
Erinnern Sie sich noch an den Moment, indem sie gemerkt haben, dass aus Ihrem Kunstprojekt etwas viel Größeres wird?
Für mich als Künstler waren die Stolpersteine anfangs einfach ein konzeptuelles Kunstwerk. Ich habe angesichts der Zahl überhaupt nicht daran geglaubt, es wirklich zu realisieren. Aber im Leben gibt es keine Zufälle, wirklich nicht. Fast gleichzeitig hatte Karlheinz Schmid, der die „Kunstzeitung“ herausgibt, damals noch in Regensburg, jetzt in Berlin, ein Buchprojekt. Kunstprojekte für Europa mit dem Titel „Größenwahn“. Und ich dachte mir „Größenwahn, das passt perfekt“. Also fertigte ich den ersten „Stolperstein“ an und er druckte ihn in seinem Buch ab. Das hat dann wiederum der Pfarrer aus meiner Gemeinde in die Hände bekommen. Er meinte daraufhin zu mir „Naja, Gunter, die Million wirst du nicht schaffen.“ Aber man kann ja klein anfangen. Stand jetzt bin ich bei 117.000 Steinen. Im Vergleich zu einer Million sind 170.000 natürlich nur ein Bruchteil. Die Symbolwirkung dieser Steine ist allerdings viel größer.
Wie lässt sich die Freude über neue Erinnerungsorte mit dem Leid der Vergangenheit vereinbaren?
Der Hintergrund des Projektes ist ja eigentlich kein Grund zur Freude. Ich kann trotzdem auch im Namen meiner Mitarbeiter sagen „Wir freuen uns über jeden Ort, der dazu kommt. Jedes Land und jeden einzelnen Stein“. Es ist schön, dass durch das Projekt immer noch eine Aufarbeitung der Vergangenheit stattfindet. Also gerade bei Behinderten-Morden: Die Enkel, die plötzlich fragen „Warum hatten wir nie eine Oma?“. Durch dieses Nachfragen kommt heraus, was damals passiert ist.
Wie gehen Sie bei fehlerhaften und entwendeten Steinen vor?
Die Inschriften auf den Steinen sind zu 99 Prozent korrekt, Fehler passieren trotzdem. Es ist schon mal vorgekommen, obwohl der Stein durch vier Korrekturen gelaufen ist, dass mich ein Mitarbeiter aus Berlin angerufen hat und meinte „Sag mal, Jahrgang 1819, kann das stimmen?“. Solche Fehler werden so schnell wie möglich ausgebessert und gestohlene Steine genauso schnell ersetzt. Bei entwendeten Steinen durch Vandalismus setzt sonst oft der „Nacharmer-Effekt“ ein und es würden dann noch mehr Steine fehlen. In solchen Fällen muss so rasch und so still wie möglich vorgegangen werden.
Wie soll das Projekt weitergeführt werden, wenn Sie die Arbeit nicht mehr selber machen können?
Erstens kann ich mir durchaus einen Fahrer leisten und beim Verlegen zugucken und Anweisungen geben. Zweitens hat mich eine Hessin gekapert und geheiratet. Sie ist 28 Jahre jünger und kann schon Stolpersteine verlegen. Sie war bereits in Deutschland, Österreich, in Lichtenstein und in der Schweiz unterwegs. Ich kriege dann immer nur zu hören „Aber der Gunter macht das viel schneller.“ Das stimmt, aber ich habe ja auch mehr als 100.000 Steine Vorsprung. Von den 117.000 verlegten Steinen habe ich in etwa 90 Prozent selber verlegt, aber inzwischen brauche ich Hilfe. Im Jahr 2019 war ich 270 Tage von zu Hause weg und irgendwann hat mein geliebtes Eheweib Katja gesagt „Ne, weniger“. Wenn ich bereits an dem jeweiligen Verlegungsort war, übernimmt der Bauhof meine Arbeit. Eine Erstverlegung mache ich aber immer noch selber, um den Leuten zu zeigen, wie man die Steine richtig verlegt. Ich sehe da also überhaupt kein Problem. Wir sind in der Stiftung gut aufgestellt.
Auguste Weinschenk
Vor dem Haus Feuchtwanger Straße 57 erinnert seit 22. März 2023
ein Stolperstein an Auguste Weinschenk, geborene Lang. Auguste, auch „Gusti“
genannt, wurde am 25. Juni 1878 in Treuchtlingen geboren.
Am 16. August 1904 heiratete sie in Ansbach den Handelsmann Gustav Weinschenk, der am 3. Oktober 1875 in Windsbach zur Welt kam. Gemeinsam hatten sie drei Kinder: Amalie (geb. 1906) sowie die Zwillinge Betty und Walter (beide geb. 1907).
1916 zog die Familie vom Wohnsitz Maximilianstraße 39 in den „Oberen Markt 23“.
Gustav Weinschenk verstarb bereits am 21. August 1924 im Alter von nur 49 Jahren und wurde in Ansbach beigesetzt; sein Grabmal existiert heute nicht mehr.
1926 verließ die älteste Tochter Amalie das Elternhaus und zog als Kinderpflegerin nach Brandenburg. Drei Jahre später, 1929, folgte Tochter Betty, die eine kaufmännische Lehre in Offenburg im Baden absolvierte. Sohn Walter war ab 1928 als Pianist viel auf Konzertreisen und meldete sich 1934 endgültig in Ansbach ab.
Nach dem Tod ihres Mannes blieb Auguste „Gusti“ Weinschenk in Ansbach und zog 1932 in die Feuchtwanger Straße 57. Dort musste sie die grausamen Ereignisse der Reichspogromnacht miterleben.
Am 22. Dezember 1938 verließ sie Ansbach und floh nach Offenburg, wo ihre Tochter Betty bereits seit neun Jahren lebte und inzwischen mit dem nichtjüdischen Künstler Oscar Knauer liiert war.
Am 22. Oktober 1940 wurde Auguste Weinschenk von Offenburg aus mit einem Sammeltransport aller badischen Juden ins französische Lager Gurs nahe den Pyrenäen deportiert. Später wurde sie in das nahegelegene Lager Masseube verlegt.
Diese Internierung bewahrte sie vermutlich vor der Deportation in die Vernichtungslager im Osten, die ab 1942 alle noch in Gurs verbliebenen Juden traf.
Auguste überlebte den Holocaust. Archivalien deuten darauf hin, dass sie sich in dieser Zeit in der Region um Lourdes aufhielt.
1949 wanderte sie in den neu gegründeten Staat Israel aus und zog 1952 schließlich nach Kanada.
Dort lebte sie noch zwei Jahre bei ihrer Tochter Betty und Schwiegersohn Oscar Knauer in Montréal in der Provinz Québec.
1954 verstarb sie im Alter von 75 Jahren und wurde auf dem Baron de Hirsch – De la Savane Cemetery in Montréal beerdigt.
Am 16. August 1904 heiratete sie in Ansbach den Handelsmann Gustav Weinschenk, der am 3. Oktober 1875 in Windsbach zur Welt kam. Gemeinsam hatten sie drei Kinder: Amalie (geb. 1906) sowie die Zwillinge Betty und Walter (beide geb. 1907).
1916 zog die Familie vom Wohnsitz Maximilianstraße 39 in den „Oberen Markt 23“.
Gustav Weinschenk verstarb bereits am 21. August 1924 im Alter von nur 49 Jahren und wurde in Ansbach beigesetzt; sein Grabmal existiert heute nicht mehr.
1926 verließ die älteste Tochter Amalie das Elternhaus und zog als Kinderpflegerin nach Brandenburg. Drei Jahre später, 1929, folgte Tochter Betty, die eine kaufmännische Lehre in Offenburg im Baden absolvierte. Sohn Walter war ab 1928 als Pianist viel auf Konzertreisen und meldete sich 1934 endgültig in Ansbach ab.
Nach dem Tod ihres Mannes blieb Auguste „Gusti“ Weinschenk in Ansbach und zog 1932 in die Feuchtwanger Straße 57. Dort musste sie die grausamen Ereignisse der Reichspogromnacht miterleben.
Am 22. Dezember 1938 verließ sie Ansbach und floh nach Offenburg, wo ihre Tochter Betty bereits seit neun Jahren lebte und inzwischen mit dem nichtjüdischen Künstler Oscar Knauer liiert war.
Am 22. Oktober 1940 wurde Auguste Weinschenk von Offenburg aus mit einem Sammeltransport aller badischen Juden ins französische Lager Gurs nahe den Pyrenäen deportiert. Später wurde sie in das nahegelegene Lager Masseube verlegt.
Diese Internierung bewahrte sie vermutlich vor der Deportation in die Vernichtungslager im Osten, die ab 1942 alle noch in Gurs verbliebenen Juden traf.
Auguste überlebte den Holocaust. Archivalien deuten darauf hin, dass sie sich in dieser Zeit in der Region um Lourdes aufhielt.
1949 wanderte sie in den neu gegründeten Staat Israel aus und zog 1952 schließlich nach Kanada.
Dort lebte sie noch zwei Jahre bei ihrer Tochter Betty und Schwiegersohn Oscar Knauer in Montréal in der Provinz Québec.
1954 verstarb sie im Alter von 75 Jahren und wurde auf dem Baron de Hirsch – De la Savane Cemetery in Montréal beerdigt.
Familie Steiner und Karoline Schloss
Vor dem Haus Schalkhäuser Straße 84 erinnern heute drei Stolpersteine an das jüdische Ehepaar Flora und Leo Steiner sowie an Leos Schwester Karoline Schloss. Sie stehen stellvertretend für das Leben, das Engagement, die Verfolgung und das Schicksal jüdischer Menschen in Ansbach während der Zeit des Nationalsozialismus.
Leo Steiner, geboren 1865 in Ansbach, war Kaufmann und betrieb unter anderem in der Kannenstraße 1 ein gut angesehenes Bekleidungsgeschäft. Zusammen mit seiner Frau Flora Steiner, geb. Lindauer (geb. 1873 in Jebenhausen), war er ein aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde. Leo engagierte sich im Verwaltungsrat der Israelitischen Kultusgemeinde, Flora war Mitglied im israelitischen Frauenverein. Die Ehe blieb kinderlos. Im Jahr 1932 zog das Ehepaar in den Ruhestand und ließ sich im eigenen Haus in der Schalkhäuser Straße 84 nieder.
Doch an einen friedlichen Lebensabend war nicht zu denken: In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurde Leo Steiner, als er bereits 73 Jahre alt war, verhaftet. Flora Steiner, gesundheitlich geschwächt, musste zeitweise ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Wohnung der Steiners wurde durch SA-Männer brutal verwüstet, wie ein Nachbar später berichtete. Möbel wurden zerstört, die Badezimmereinrichtung demoliert, Flora und ihre Haushälterin wurden in ein Zimmer gesperrt und riefen um Hilfe. Nach der Entlassung aus der sogenannten „Schutzhaft“ blieb dem Ehepaar kaum Zeit: Auf Anweisung des Stadtrats mussten bis Januar 1939 alle Juden Ansbach verlassen haben.
Bereits Anfang Dezember 1938 verkauften die Steiners ihr Anwesen weit unter Wert an den NS-Kreispropagandaleiter Georg Bezold und dessen Frau. Der offizielle Kaufpreis betrug nur 23.000 Reichsmark, obwohl das Haus einen deutlich höheren Wert hatte. Leo und Flora Steiner zogen zunächst nach Stuttgart und konnten schließlich in die Schweiz fliehen. Leo Steiner überlebte den Krieg, lebte später im jüdischen Altenheim in Fürth und bekam 1950 sein Haus zurückübertragen.
Karoline Schloss, geborene Steiner, war die ältere Schwester von Leo. Sie wurde 1862 in Ansbach geboren, heiratete 1893 und lebte lange in Nürnberg. Als Witwe kehrte sie in den 1930er-Jahren zu ihrem Bruder nach Ansbach zurück. Im August 1938 verließ sie Ansbach wieder und kehrte nach Nürnberg zurück. Dort war sie als 76-jährige Witwe weitgehend ohne Fluchtmöglichkeiten. Am 10. September 1942 wurde sie, zusammen mit vielen älteren Nürnberger Jüdinnen und Juden, nach Theresienstadt deportiert. Dort starb sie nur wenige Monate später, am 28. Februar 1943, mit fast 81 Jahren an Altersschwäche.
Seit 21. Juli 2021 und 28. Mai 2025 erinnern die drei Stolpersteine an Flora und Leo Steiner sowie an Karoline Schloss. An Menschen, deren Leben durch Verfolgung, Vertreibung und Gewalt zutiefst erschüttert wurde.
Leo Steiner, geboren 1865 in Ansbach, war Kaufmann und betrieb unter anderem in der Kannenstraße 1 ein gut angesehenes Bekleidungsgeschäft. Zusammen mit seiner Frau Flora Steiner, geb. Lindauer (geb. 1873 in Jebenhausen), war er ein aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde. Leo engagierte sich im Verwaltungsrat der Israelitischen Kultusgemeinde, Flora war Mitglied im israelitischen Frauenverein. Die Ehe blieb kinderlos. Im Jahr 1932 zog das Ehepaar in den Ruhestand und ließ sich im eigenen Haus in der Schalkhäuser Straße 84 nieder.
Doch an einen friedlichen Lebensabend war nicht zu denken: In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurde Leo Steiner, als er bereits 73 Jahre alt war, verhaftet. Flora Steiner, gesundheitlich geschwächt, musste zeitweise ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Wohnung der Steiners wurde durch SA-Männer brutal verwüstet, wie ein Nachbar später berichtete. Möbel wurden zerstört, die Badezimmereinrichtung demoliert, Flora und ihre Haushälterin wurden in ein Zimmer gesperrt und riefen um Hilfe. Nach der Entlassung aus der sogenannten „Schutzhaft“ blieb dem Ehepaar kaum Zeit: Auf Anweisung des Stadtrats mussten bis Januar 1939 alle Juden Ansbach verlassen haben.
Bereits Anfang Dezember 1938 verkauften die Steiners ihr Anwesen weit unter Wert an den NS-Kreispropagandaleiter Georg Bezold und dessen Frau. Der offizielle Kaufpreis betrug nur 23.000 Reichsmark, obwohl das Haus einen deutlich höheren Wert hatte. Leo und Flora Steiner zogen zunächst nach Stuttgart und konnten schließlich in die Schweiz fliehen. Leo Steiner überlebte den Krieg, lebte später im jüdischen Altenheim in Fürth und bekam 1950 sein Haus zurückübertragen.
Karoline Schloss, geborene Steiner, war die ältere Schwester von Leo. Sie wurde 1862 in Ansbach geboren, heiratete 1893 und lebte lange in Nürnberg. Als Witwe kehrte sie in den 1930er-Jahren zu ihrem Bruder nach Ansbach zurück. Im August 1938 verließ sie Ansbach wieder und kehrte nach Nürnberg zurück. Dort war sie als 76-jährige Witwe weitgehend ohne Fluchtmöglichkeiten. Am 10. September 1942 wurde sie, zusammen mit vielen älteren Nürnberger Jüdinnen und Juden, nach Theresienstadt deportiert. Dort starb sie nur wenige Monate später, am 28. Februar 1943, mit fast 81 Jahren an Altersschwäche.
Seit 21. Juli 2021 und 28. Mai 2025 erinnern die drei Stolpersteine an Flora und Leo Steiner sowie an Karoline Schloss. An Menschen, deren Leben durch Verfolgung, Vertreibung und Gewalt zutiefst erschüttert wurde.
Familie Dietenhöfer
Vor dem heutigen Gebäude der Fränkischen Landeszeitung
in der Nürnberger Straße 11 erinnern seit dem 6. November 2019 drei
Stolpersteine an die jüdische Familie Dietenhöfer:
An Ludwig Dietenhöfer, seine Frau Babette und ihren Sohn Kurt. Ludwig Dietenhöfer, der am 1. August 1870 in Dietenhofen zur Welt kam. Mit acht Jahren zog er mit seinen Eltern David und Rosa nach Ansbach, wo er das Gymnasium Carolinum besuchte und sein Abitur ablegte.
Im Jahr 1895 heiratete er Babette Weissmann, geboren 1874 in Egenhausen. Sie stammte aus der bekannten jüdischen Viehhändlerfamilie Weissmann, für deren Angehörige ebenfalls Stolpersteine in Ansbach erinnern.
Das Ehepaar ließ sich in der Nürnberger Straße 11 nieder und bekam fünf Kinder: Theodor, Fritz, Alice, Kurt und Otto. Gemeinsam mit dem Verwandten Justin Weissmann betrieb Ludwig die Metallkapselfirma „C. Th. Arnold“, die sich direkt im Haus befand. Ludwig Dietenhöfer war ein angesehener Unternehmer und Bürger.
1908 wurde er als Teilhaber der Firma eingetragen. Er war viele Jahre ehrenamtlicher Handelsrichter, saß im Ansbacher Stadtrat und im Vorstand der jüdischen Gemeinde, engagierte sich für die Renovierung der Synagoge und die Erweiterung des Friedhofs. 1931 erhielt er den Ehrentitel „Kommerzienrat“. Ihr ältester Sohn Theodor diente im Ersten Weltkrieg als Leutnant und starb 1923 an den Folgen einer im Krieg erlittenen Lungenkrankheit. Sein Grabstein auf dem jüdischen Friedhof erinnert noch heute an ihn.
Die Söhne Fritz und Otto zogen in den 1920er Jahren nach Nürnberg, Otto emigrierte 1931 nach Palästina und schloss sich einem Kibbuz an.
Tochter Alice heiratete 1929 in die Familie Adler und zog nach Haßfurt. In den 1930er Jahren lebten noch Ludwig, Babette und ihr jüngster Sohn Kurt in Ansbach.
Angesichts der zunehmenden antisemitischen Repressionen entschloss sich Ludwig 1936 zum Umzug nach Nürnberg. Kurt war bereits 1933 nach London emigriert, 1939 folgte er seinem Bruder nach Palästina.
Auch Ludwig und Babette konnten dorthin fliehen und fanden bei ihrem Sohn Otto Zuflucht. Nach dem Krieg stellten die Kinder der Familie Wiedergutmachungsforderungen gegenüber dem damaligen Besitzer der Fabrik, Heinrich Hartmann. Die Angelegenheit wurde in einem Vergleich beigelegt.
Sohn Kurt hielt auch nach dem Krieg den Kontakt zu seiner alten Heimatstadt und besuchte Ansbach regelmäßig.
Die Stolpersteine vor dem ehemaligen Fabrikgebäude erinnern heute an eine Familie, die über Generationen hinweg das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Ansbach mitgeprägt hat, und deren Geschichte durch die Verfolgung im Nationalsozialismus eine jähe Zäsur erfuhr.
An Ludwig Dietenhöfer, seine Frau Babette und ihren Sohn Kurt. Ludwig Dietenhöfer, der am 1. August 1870 in Dietenhofen zur Welt kam. Mit acht Jahren zog er mit seinen Eltern David und Rosa nach Ansbach, wo er das Gymnasium Carolinum besuchte und sein Abitur ablegte.
Im Jahr 1895 heiratete er Babette Weissmann, geboren 1874 in Egenhausen. Sie stammte aus der bekannten jüdischen Viehhändlerfamilie Weissmann, für deren Angehörige ebenfalls Stolpersteine in Ansbach erinnern.
Das Ehepaar ließ sich in der Nürnberger Straße 11 nieder und bekam fünf Kinder: Theodor, Fritz, Alice, Kurt und Otto. Gemeinsam mit dem Verwandten Justin Weissmann betrieb Ludwig die Metallkapselfirma „C. Th. Arnold“, die sich direkt im Haus befand. Ludwig Dietenhöfer war ein angesehener Unternehmer und Bürger.
1908 wurde er als Teilhaber der Firma eingetragen. Er war viele Jahre ehrenamtlicher Handelsrichter, saß im Ansbacher Stadtrat und im Vorstand der jüdischen Gemeinde, engagierte sich für die Renovierung der Synagoge und die Erweiterung des Friedhofs. 1931 erhielt er den Ehrentitel „Kommerzienrat“. Ihr ältester Sohn Theodor diente im Ersten Weltkrieg als Leutnant und starb 1923 an den Folgen einer im Krieg erlittenen Lungenkrankheit. Sein Grabstein auf dem jüdischen Friedhof erinnert noch heute an ihn.
Die Söhne Fritz und Otto zogen in den 1920er Jahren nach Nürnberg, Otto emigrierte 1931 nach Palästina und schloss sich einem Kibbuz an.
Tochter Alice heiratete 1929 in die Familie Adler und zog nach Haßfurt. In den 1930er Jahren lebten noch Ludwig, Babette und ihr jüngster Sohn Kurt in Ansbach.
Angesichts der zunehmenden antisemitischen Repressionen entschloss sich Ludwig 1936 zum Umzug nach Nürnberg. Kurt war bereits 1933 nach London emigriert, 1939 folgte er seinem Bruder nach Palästina.
Auch Ludwig und Babette konnten dorthin fliehen und fanden bei ihrem Sohn Otto Zuflucht. Nach dem Krieg stellten die Kinder der Familie Wiedergutmachungsforderungen gegenüber dem damaligen Besitzer der Fabrik, Heinrich Hartmann. Die Angelegenheit wurde in einem Vergleich beigelegt.
Sohn Kurt hielt auch nach dem Krieg den Kontakt zu seiner alten Heimatstadt und besuchte Ansbach regelmäßig.
Die Stolpersteine vor dem ehemaligen Fabrikgebäude erinnern heute an eine Familie, die über Generationen hinweg das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Ansbach mitgeprägt hat, und deren Geschichte durch die Verfolgung im Nationalsozialismus eine jähe Zäsur erfuhr.
Ehepaar Gutmann
Vor dem Haus Johannisweg 6 erinnern seit 22. Mai 2023 zwei
Stolpersteine an das Ehepaar Hermann und Hedwig Gutmann, geborene Gerstle.
Hermann Gutmann, Handelsmann und Kommissionär, wurde am 3. November 1874 in Leutershausen als Sohn der Kaufleute Gustav und Jette Gutmann geboren. Seine Schwester Ida Uhlfelder ist ebenfalls durch einen Stolperstein am Karlsplatz 7 geehrt.
Hedwig Gerstle kam am 21. August 1880 in Ichenhausen im schwäbischen Raum als Tochter von Jakob und Katharina Gerstle zur Welt. Hedwig zog 1895, Hermann 1899 nach Ansbach, wo sie am 17. Mai 1900 heirateten.
Das Paar bekam vier Söhne: Max (geboren 1904), Arthur (1906) sowie die Zwillinge Wilhelm und Theodor (1914).
Die Familie lebte in der Oberhäuserstraße 19, wo ebenfalls Stolpersteine an die Metzgersfamilie Stühler erinnern.
Zwischen 1919 und 1934 verließen alle Söhne das Elternhaus und Ansbach. Hermanns Eltern, Gustav und Jette Gutmann, die ebenfalls in Ansbach lebten, starben in den 1920er Jahren. Eine verblüffende Zahl aus jener Zeit: Für die Reservierung eines Grabes für seine Mutter zahlte Hermann Gutmann am 29. Oktober 1923, während der Inflation, unglaubliche 10 Milliarden Mark.
Aufgrund der zunehmenden Verfolgung durch das NS-Regime beschlossen Hermann und Hedwig Gutmann 1937, Deutschland und Ansbach zu verlassen und in die USA zu fliehen.
Am 19. Mai 1937 meldeten sie sich offiziell nach New York ab. Drei ihrer Kinder waren bereits zuvor in die USA geflohen, nur Max lebte zu dieser Zeit in Paris.
Von Southampton aus setzten Hermann und Hedwig mit dem Schiff Aquitania nach New York über, wo sie am 1. Juni 1937 ankamen.
Doch ein langes Leben in Sicherheit war ihnen nicht mehr vergönnt: Hedwig verstarb am 27. März 1941 im Alter von 60 Jahren, Hermann folgte ihr am 19. Dezember 1946 im Alter von 72 Jahren.
Beide sind auf dem Cedar Park Cemetery in Paramus, New Jersey, beerdigt; ihre Gräber liegen direkt nebeneinander und sind bis heute erhalten. Auf demselben Friedhof liegen auch Gabriel und Regine Wittelshöfer begraben.
Dem letzten in Europa verbliebenen Sohn Max Gutmann gelang im Juni 1944 noch die Flucht in die USA über die Schweiz, während des Krieges.
Hermann Gutmann, Handelsmann und Kommissionär, wurde am 3. November 1874 in Leutershausen als Sohn der Kaufleute Gustav und Jette Gutmann geboren. Seine Schwester Ida Uhlfelder ist ebenfalls durch einen Stolperstein am Karlsplatz 7 geehrt.
Hedwig Gerstle kam am 21. August 1880 in Ichenhausen im schwäbischen Raum als Tochter von Jakob und Katharina Gerstle zur Welt. Hedwig zog 1895, Hermann 1899 nach Ansbach, wo sie am 17. Mai 1900 heirateten.
Das Paar bekam vier Söhne: Max (geboren 1904), Arthur (1906) sowie die Zwillinge Wilhelm und Theodor (1914).
Die Familie lebte in der Oberhäuserstraße 19, wo ebenfalls Stolpersteine an die Metzgersfamilie Stühler erinnern.
Zwischen 1919 und 1934 verließen alle Söhne das Elternhaus und Ansbach. Hermanns Eltern, Gustav und Jette Gutmann, die ebenfalls in Ansbach lebten, starben in den 1920er Jahren. Eine verblüffende Zahl aus jener Zeit: Für die Reservierung eines Grabes für seine Mutter zahlte Hermann Gutmann am 29. Oktober 1923, während der Inflation, unglaubliche 10 Milliarden Mark.
Aufgrund der zunehmenden Verfolgung durch das NS-Regime beschlossen Hermann und Hedwig Gutmann 1937, Deutschland und Ansbach zu verlassen und in die USA zu fliehen.
Am 19. Mai 1937 meldeten sie sich offiziell nach New York ab. Drei ihrer Kinder waren bereits zuvor in die USA geflohen, nur Max lebte zu dieser Zeit in Paris.
Von Southampton aus setzten Hermann und Hedwig mit dem Schiff Aquitania nach New York über, wo sie am 1. Juni 1937 ankamen.
Doch ein langes Leben in Sicherheit war ihnen nicht mehr vergönnt: Hedwig verstarb am 27. März 1941 im Alter von 60 Jahren, Hermann folgte ihr am 19. Dezember 1946 im Alter von 72 Jahren.
Beide sind auf dem Cedar Park Cemetery in Paramus, New Jersey, beerdigt; ihre Gräber liegen direkt nebeneinander und sind bis heute erhalten. Auf demselben Friedhof liegen auch Gabriel und Regine Wittelshöfer begraben.
Dem letzten in Europa verbliebenen Sohn Max Gutmann gelang im Juni 1944 noch die Flucht in die USA über die Schweiz, während des Krieges.
Therese Selling
Seit dem 11. Februar 2024 erinnert ein Stolperstein vor dem Haus Maximilianstraße 14 in Ansbach an Therese Selling, geborene Obermeyer. Sie wurde am 6. Oktober 1853 in Steinhart geboren, einem heutigen Ortsteil der Gemeinde Hainsfarth im Landkreis Donau-Ries. Therese entstammte einer jüdischen Familie mit insgesamt neun Kindern. Ihre Eltern waren Nathan Obermeyer, ein Glaser, und Meile Obermeyer, geborene Weihermann aus Feuchtwangen.
Von den neun Kindern überlebten nur vier die Kindheit, darunter Therese, ihre Schwestern Jette und Jeanette sowie der Bruder Jakob Obermeyer, der später als Orientforscher internationale Bekanntheit erlangte. Die drei Schwestern zog es alle nach Ansbach, wo sie sich niederließen, ihr Leben verbrachten und auch beerdigt wurden. Ihre Grabsteine sind bis heute auf dem jüdischen Friedhof in Ansbach erhalten.
Therese Obermeyer heiratete am 23. Mai 1875 den Kaufmann Julius Selling aus Colmberg. Er war Sohn von Mathias und Mina Selling und übernahm später eine zentrale Rolle im jüdischen Gemeindeleben von Ansbach, unter anderem als Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde. Gemeinsam lebte das Ehepaar Selling in Ansbach und wurde fester Bestandteil der jüdischen Gemeinschaft.
Nach dem Tod von Julius Selling am 7. Juni 1927, im Alter von 77 Jahren, blieb Therese als Witwe zurück. In verschiedenen Archiven wird sie später als „Kleinrentnerswitwe“ geführt, sie wohnte im zweiten Stock der Maximilianstraße 14. Ihre ledige Schwester Jette und ihr Vater Nathan lebten ebenfalls zeitweise in Ansbach, verstarben jedoch bereits vor der Jahrhundertwende. Auch ihre Schwester Jeanette Rosenfeld, verheiratet mit Wolf Rosenfeld, starb 1925. An ihren Neffen Josef Rosenfeld, der ebenfalls Opfer des NS-Regimes wurde, erinnert ein weiterer Stolperstein in der Feuerbachstraße.
In den letzten Lebensjahren musste Therese Selling die zunehmenden antisemitischen Repressionen der 1930er-Jahre miterleben – wie viele jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Die Reichspogromnacht im November 1938 erlebte sie jedoch nicht mehr. Therese Selling starb am 13. März 1937 im Alter von 83 Jahren.
Sie wurde auf dem jüdischen Friedhof in Ansbach neben ihrem Ehemann beerdigt. Besonders ist ihr Grabmal: Es handelt sich um einen der wenigen erhaltenen Doppelgrabsteine auf dem Friedhof, ein stilles, aber bleibendes Zeugnis ihrer gemeinsamen Lebensgeschichte.
Mit dem Stolperstein in der Maximilianstraße bleibt auch Therese Selling in Erinnerung, als Teil einer einst lebendigen jüdischen Gemeinde, deren Mitglieder durch Verfolgung, Vertreibung und Tod aus dem Stadtbild verschwanden.
Von den neun Kindern überlebten nur vier die Kindheit, darunter Therese, ihre Schwestern Jette und Jeanette sowie der Bruder Jakob Obermeyer, der später als Orientforscher internationale Bekanntheit erlangte. Die drei Schwestern zog es alle nach Ansbach, wo sie sich niederließen, ihr Leben verbrachten und auch beerdigt wurden. Ihre Grabsteine sind bis heute auf dem jüdischen Friedhof in Ansbach erhalten.
Therese Obermeyer heiratete am 23. Mai 1875 den Kaufmann Julius Selling aus Colmberg. Er war Sohn von Mathias und Mina Selling und übernahm später eine zentrale Rolle im jüdischen Gemeindeleben von Ansbach, unter anderem als Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde. Gemeinsam lebte das Ehepaar Selling in Ansbach und wurde fester Bestandteil der jüdischen Gemeinschaft.
Nach dem Tod von Julius Selling am 7. Juni 1927, im Alter von 77 Jahren, blieb Therese als Witwe zurück. In verschiedenen Archiven wird sie später als „Kleinrentnerswitwe“ geführt, sie wohnte im zweiten Stock der Maximilianstraße 14. Ihre ledige Schwester Jette und ihr Vater Nathan lebten ebenfalls zeitweise in Ansbach, verstarben jedoch bereits vor der Jahrhundertwende. Auch ihre Schwester Jeanette Rosenfeld, verheiratet mit Wolf Rosenfeld, starb 1925. An ihren Neffen Josef Rosenfeld, der ebenfalls Opfer des NS-Regimes wurde, erinnert ein weiterer Stolperstein in der Feuerbachstraße.
In den letzten Lebensjahren musste Therese Selling die zunehmenden antisemitischen Repressionen der 1930er-Jahre miterleben – wie viele jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Die Reichspogromnacht im November 1938 erlebte sie jedoch nicht mehr. Therese Selling starb am 13. März 1937 im Alter von 83 Jahren.
Sie wurde auf dem jüdischen Friedhof in Ansbach neben ihrem Ehemann beerdigt. Besonders ist ihr Grabmal: Es handelt sich um einen der wenigen erhaltenen Doppelgrabsteine auf dem Friedhof, ein stilles, aber bleibendes Zeugnis ihrer gemeinsamen Lebensgeschichte.
Mit dem Stolperstein in der Maximilianstraße bleibt auch Therese Selling in Erinnerung, als Teil einer einst lebendigen jüdischen Gemeinde, deren Mitglieder durch Verfolgung, Vertreibung und Tod aus dem Stadtbild verschwanden.
Frida Neuburger
Vor dem Haus in der Würzburger Straße 37 erinnert seit dem
21. Juli 2021 ein Stolperstein an Frieda Neuburger, eine Frau, deren Lebensweg
exemplarisch für viele vergessene Opfer der NS-Zeit steht.
Frieda Neuburger wurde am 2. November 1883 in Heidelberg geboren. Sie blieb unverheiratet und arbeitete zunächst als Dienstmädchen.
Ein Unfall oder eine schwere Krankheit führte zu einer Lähmung an einem Arm, deswegen musste sie ihren Beruf aufgeben und lebte von einer kleinen Invalidenrente.
1933 zog Frieda Neuburger von der Jüdtstraße 46 in eine Wohnung im zweiten Stock der Würzburger Straße 37.
Dort lebte sie allein und zurückgezogen, doch auch sie blieb nicht verschont von den zunehmenden Repressalien gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger. Im Zuge des Novemberpogroms 1938 musste Frieda Neuburger Ansbach verlassen. Ihre offizielle Abmeldung datiert vom 29. Dezember 1938, als neuen Wohnort gibt das Meldeamt die Stadt Würzburg an.
Dort fand sie zunächst Aufnahme in den Einrichtungen der Israelitischen Kranken- und Pfründnerhausstiftung, in der Bibrastraße 6 und später in der Dürerstraße 20. Am 10. September 1942 wurde Frieda Neuburger mit dem ersten großen Alterstransport aus Franken in das Ghetto Theresienstadt deportiert.
Wenige Monate später, am 23. Januar 1943, wurde sie von dort aus weiter nach Auschwitz verschleppt.
Über ihr weiteres Schicksal ist nichts Genaues bekannt, doch mit großer Wahrscheinlichkeit wurde sie kurz nach ihrer Ankunft im Vernichtungslager ermordet. Ein offizielles Todesdatum ist nicht überliefert.
Der Stolperstein vor der Würzburger Straße 37 gibt Frieda Neuburger heute symbolisch einen Platz in der Erinnerung zurück.
Frieda Neuburger wurde am 2. November 1883 in Heidelberg geboren. Sie blieb unverheiratet und arbeitete zunächst als Dienstmädchen.
Ein Unfall oder eine schwere Krankheit führte zu einer Lähmung an einem Arm, deswegen musste sie ihren Beruf aufgeben und lebte von einer kleinen Invalidenrente.
1933 zog Frieda Neuburger von der Jüdtstraße 46 in eine Wohnung im zweiten Stock der Würzburger Straße 37.
Dort lebte sie allein und zurückgezogen, doch auch sie blieb nicht verschont von den zunehmenden Repressalien gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger. Im Zuge des Novemberpogroms 1938 musste Frieda Neuburger Ansbach verlassen. Ihre offizielle Abmeldung datiert vom 29. Dezember 1938, als neuen Wohnort gibt das Meldeamt die Stadt Würzburg an.
Dort fand sie zunächst Aufnahme in den Einrichtungen der Israelitischen Kranken- und Pfründnerhausstiftung, in der Bibrastraße 6 und später in der Dürerstraße 20. Am 10. September 1942 wurde Frieda Neuburger mit dem ersten großen Alterstransport aus Franken in das Ghetto Theresienstadt deportiert.
Wenige Monate später, am 23. Januar 1943, wurde sie von dort aus weiter nach Auschwitz verschleppt.
Über ihr weiteres Schicksal ist nichts Genaues bekannt, doch mit großer Wahrscheinlichkeit wurde sie kurz nach ihrer Ankunft im Vernichtungslager ermordet. Ein offizielles Todesdatum ist nicht überliefert.
Der Stolperstein vor der Würzburger Straße 37 gibt Frieda Neuburger heute symbolisch einen Platz in der Erinnerung zurück.
Regina und Armin Weiss
Vor dem Haus Reitbahn 1 erinnern seit dem 28. Mai 2015 zwei
Stolpersteine an Regina Weiss und ihren Sohn Armin.
Bis Ende 1938 lebten beide in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss dieses Gebäudes. Gemeinsam betrieben sie das Herren- und Knabenbekleidungsgeschäft „Zum Matrosen“ in der Uzstraße 39, direkt neben dem Schuhhaus Lebrecht/Liebermann, auch für deren Familien wurden an diesem Tag Stolpersteine verlegt.
Regina Weiss wurde am 28. August 1865 in der Stadt Waitzen an der Donau geboren, dem heutigen Vác in Ungarn. Ihre Eltern waren Simon Grünwald und Fanny Grünwald, geborene Spitzer. In ihrer Heimat heiratete sie Gabriel Gabor Weiss, ebenfalls in Waitzen geboren am 10. März 1865.
Das Ehepaar bekam sechs Kinder, deren Geburtsorte erzählen die Geschichte einer stetig wandernden Familie:
Nach dem Tod ihres Mannes am 1. Januar 1926 führte Regina das Geschäft gemeinsam mit ihrem Sohn Armin weiter.
1929 verließ sie die Wohnung über dem Laden und zog in eine Mietwohnung in der Reitbahn 1, in das zweite Obergeschoss eines Mehrparteienhauses im Besitz der Kaufmannswitwe Anna Kotte.
1933 folgte ihr Sohn Armin und zog ebenfalls dorthin. Am 19. Oktober 1938, wenige Wochen vor der Pogromnacht, flohen Armin und sein Bruder Moritz nach Budapest. Dort verliert sich ihre Spur.
Es gibt Hinweise, dass sie in ein Lager im slowakischen Garany deportiert wurden. Ihr genaues Schicksal ist unbekannt, beide gelten als verschollen und haben die Shoah höchstwahrscheinlich nicht überlebt.
Regina Weiss verließ Ansbach erst kurz vor Ablauf der vom Stadtrat gesetzten Ausreisefrist, am 29. Dezember 1938, im Alter von 73 Jahren. Sie flüchtete nach München, wo sie mehrfach den Wohnort wechselte und schließlich im Altersheim der Israelitischen Kultusgemeinde in der Mathildenstraße lebte, gemeinsam mit Karoline Lebrecht, ihrer früheren Nachbarin aus Ansbach.
Am 15. April 1942 wurde Regina in ein Barackenlager in der Münchner Knorrstraße gebracht.
Am 20. April 1943 folgte die Deportation nach Theresienstadt, von dort am 18. Dezember weiter nach Auschwitz, wo sie am 30. Dezember 1943 im Alter von 78 Jahren ermordet wurde.
Und was wurde aus den anderen Kindern der Familie Weiss?
Bis Ende 1938 lebten beide in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss dieses Gebäudes. Gemeinsam betrieben sie das Herren- und Knabenbekleidungsgeschäft „Zum Matrosen“ in der Uzstraße 39, direkt neben dem Schuhhaus Lebrecht/Liebermann, auch für deren Familien wurden an diesem Tag Stolpersteine verlegt.
Regina Weiss wurde am 28. August 1865 in der Stadt Waitzen an der Donau geboren, dem heutigen Vác in Ungarn. Ihre Eltern waren Simon Grünwald und Fanny Grünwald, geborene Spitzer. In ihrer Heimat heiratete sie Gabriel Gabor Weiss, ebenfalls in Waitzen geboren am 10. März 1865.
Das Ehepaar bekam sechs Kinder, deren Geburtsorte erzählen die Geschichte einer stetig wandernden Familie:
- Helene, geboren 1889 in Waitzen
- Klementine Gabriele, geboren 1890 in Wien
- Armin, geboren am 13. Oktober 1894 in Wien
- Simon, geboren 1898 in München
- Moritz, geboren 1900 in München
- Richard, geboren 1901 in München
Nach dem Tod ihres Mannes am 1. Januar 1926 führte Regina das Geschäft gemeinsam mit ihrem Sohn Armin weiter.
1929 verließ sie die Wohnung über dem Laden und zog in eine Mietwohnung in der Reitbahn 1, in das zweite Obergeschoss eines Mehrparteienhauses im Besitz der Kaufmannswitwe Anna Kotte.
1933 folgte ihr Sohn Armin und zog ebenfalls dorthin. Am 19. Oktober 1938, wenige Wochen vor der Pogromnacht, flohen Armin und sein Bruder Moritz nach Budapest. Dort verliert sich ihre Spur.
Es gibt Hinweise, dass sie in ein Lager im slowakischen Garany deportiert wurden. Ihr genaues Schicksal ist unbekannt, beide gelten als verschollen und haben die Shoah höchstwahrscheinlich nicht überlebt.
Regina Weiss verließ Ansbach erst kurz vor Ablauf der vom Stadtrat gesetzten Ausreisefrist, am 29. Dezember 1938, im Alter von 73 Jahren. Sie flüchtete nach München, wo sie mehrfach den Wohnort wechselte und schließlich im Altersheim der Israelitischen Kultusgemeinde in der Mathildenstraße lebte, gemeinsam mit Karoline Lebrecht, ihrer früheren Nachbarin aus Ansbach.
Am 15. April 1942 wurde Regina in ein Barackenlager in der Münchner Knorrstraße gebracht.
Am 20. April 1943 folgte die Deportation nach Theresienstadt, von dort am 18. Dezember weiter nach Auschwitz, wo sie am 30. Dezember 1943 im Alter von 78 Jahren ermordet wurde.
Und was wurde aus den anderen Kindern der Familie Weiss?
- Klementine floh nach Budapest, überlebte und kehrte nach München zurück, wo sie 1986 im Alter von 95 Jahren starb.
- Helene, verheiratete Schrey, überlebte ebenfalls und verstarb 1987 im Alter von 97 Jahren, ebenfalls in München.
- Richard gelang im November 1938 die Emigration nach Asien, entweder nach Bangkok oder Bombay. Später lebte er in San Francisco und starb 1994 im Alter von 93 Jahren in Anaheim, Kalifornien.
Ehepaar Lehmann
Vor dem Wohnhaus in der Bischof-Meiser-Straße 5 erinnern
seit dem 22. März 2023 zwei Stolpersteine an das Ehepaar Jonathan und Berta
Lehmann.
Die beiden lebten hier bis zur Reichspogromnacht im November 1938.
Jonathan Lehmann wurde am 6. Februar 1882 in Obernzenn geboren. Er stammte aus einer jüdischen Viehhändlerfamilie; seine Eltern waren Abraham und Hanna Lehmann, geborene Uffenheimer.
Berta Reiss, seine spätere Ehefrau, kam am 15. August 1874 im hessischen Gelnhausen zur Welt. Sie war die Tochter von Meir und Regina Reiss.
Am 4. April 1911 heirateten die beiden in Egenhausen bei Obernzenn, einem Ort mit einer damals noch aktiven jüdischen Gemeinde. Dort kam am 28. September 1912 ihr Sohn Albert zur Welt.
Bereits ein Jahr später, am 15. September 1913, zog die junge Familie nach Ansbach. Während des Ersten Weltkriegs diente Jonathan Lehmann von Juli 1915 bis August 1918 an der Front. In den Militärunterlagen wird sein Verhalten als „sehr gut“ und „straffrei“ beschrieben, besonders hervorgehoben wird sein Einsatz bei den Kämpfen an der Aisne und in der Doppelschlacht Aisne-Champagne.
Nach Kriegsende kehrte Jonathan nach Ansbach zurück und nahm wieder seine Tätigkeit als Viehhändler auf.
Sohn Albert verließ 1926 im Alter von 14 Jahren das Elternhaus und zog nach Schopfloch. Er sollte als einziger der Familie die Shoah überleben und später in Yad Vashem ein Gedenkblatt für seine Eltern ausfüllen.
Jonathan und Berta blieben in Ansbach und mussten in den 1930er Jahren die immer stärker werdende Entrechtung und Bedrohung der jüdischen Bevölkerung miterleben, schließlich auch die Gewalt der Pogromnacht am 9. November 1938. In dieser Nacht wurde nicht nur die Synagoge geschändet, SA-Leute und NS-Sympathisanten drangen auch in die Wohnungen jüdischer Bürger ein, verwüsteten sie und verschleppten die Männer in sogenannte „Schutzhaft“.
Auch die Wohnung der Lehmanns wurde zerstört. Jonathan Lehmann wurde von der Gestapo verhaftet und nach Nürnberg gebracht.
Kurz darauf, am 11. November 1938, meldete sich auch Berta Lehmann nach Nürnberg ab, das Ehepaar lebte fortan dort. Eine Ausreise gelang ihnen nicht mehr.
Jonathan verstarb am 18. Juni 1941 in Fürth an einer Hirnblutung. Er wurde 59 Jahre alt, sein genauer Begräbnisort ist nicht dokumentiert.
Berta wurde am 10. September 1942 deportiert, zunächst nach Theresienstadt. Am 18. Mai 1944 wurde sie nach Auschwitz gebracht und dort kurz darauf ermordet.
Nur ihr Sohn Albert überlebte die NS-Verfolgung.
Die beiden Stolpersteine vor dem ehemaligen Wohnhaus erinnern heute an seine Eltern, an ein jüdisches Ehepaar, das in Ansbach lebte, arbeitete, über Jahre Teil der Stadtgesellschaft war und dem schließlich Flucht und Überleben verwehrt blieben.
Die beiden lebten hier bis zur Reichspogromnacht im November 1938.
Jonathan Lehmann wurde am 6. Februar 1882 in Obernzenn geboren. Er stammte aus einer jüdischen Viehhändlerfamilie; seine Eltern waren Abraham und Hanna Lehmann, geborene Uffenheimer.
Berta Reiss, seine spätere Ehefrau, kam am 15. August 1874 im hessischen Gelnhausen zur Welt. Sie war die Tochter von Meir und Regina Reiss.
Am 4. April 1911 heirateten die beiden in Egenhausen bei Obernzenn, einem Ort mit einer damals noch aktiven jüdischen Gemeinde. Dort kam am 28. September 1912 ihr Sohn Albert zur Welt.
Bereits ein Jahr später, am 15. September 1913, zog die junge Familie nach Ansbach. Während des Ersten Weltkriegs diente Jonathan Lehmann von Juli 1915 bis August 1918 an der Front. In den Militärunterlagen wird sein Verhalten als „sehr gut“ und „straffrei“ beschrieben, besonders hervorgehoben wird sein Einsatz bei den Kämpfen an der Aisne und in der Doppelschlacht Aisne-Champagne.
Nach Kriegsende kehrte Jonathan nach Ansbach zurück und nahm wieder seine Tätigkeit als Viehhändler auf.
Sohn Albert verließ 1926 im Alter von 14 Jahren das Elternhaus und zog nach Schopfloch. Er sollte als einziger der Familie die Shoah überleben und später in Yad Vashem ein Gedenkblatt für seine Eltern ausfüllen.
Jonathan und Berta blieben in Ansbach und mussten in den 1930er Jahren die immer stärker werdende Entrechtung und Bedrohung der jüdischen Bevölkerung miterleben, schließlich auch die Gewalt der Pogromnacht am 9. November 1938. In dieser Nacht wurde nicht nur die Synagoge geschändet, SA-Leute und NS-Sympathisanten drangen auch in die Wohnungen jüdischer Bürger ein, verwüsteten sie und verschleppten die Männer in sogenannte „Schutzhaft“.
Auch die Wohnung der Lehmanns wurde zerstört. Jonathan Lehmann wurde von der Gestapo verhaftet und nach Nürnberg gebracht.
Kurz darauf, am 11. November 1938, meldete sich auch Berta Lehmann nach Nürnberg ab, das Ehepaar lebte fortan dort. Eine Ausreise gelang ihnen nicht mehr.
Jonathan verstarb am 18. Juni 1941 in Fürth an einer Hirnblutung. Er wurde 59 Jahre alt, sein genauer Begräbnisort ist nicht dokumentiert.
Berta wurde am 10. September 1942 deportiert, zunächst nach Theresienstadt. Am 18. Mai 1944 wurde sie nach Auschwitz gebracht und dort kurz darauf ermordet.
Nur ihr Sohn Albert überlebte die NS-Verfolgung.
Die beiden Stolpersteine vor dem ehemaligen Wohnhaus erinnern heute an seine Eltern, an ein jüdisches Ehepaar, das in Ansbach lebte, arbeitete, über Jahre Teil der Stadtgesellschaft war und dem schließlich Flucht und Überleben verwehrt blieben.
Dr. Berthold Daniels und Elise Daniels
Am 6. November 2019 wurden vor dem Haus in der Jüdtstraße 20
zwei Stolpersteine verlegt, für Dr. Berthold Daniels und seine Mutter Elise
Daniels, geborene Buchthal.
Dr. Berthold Daniels wurde 1901 in Hamburg geboren. Er studierte zuerst Mathematik und Physik, wechselte dann zur Medizin und wurde Augenarzt. 1932 zog er nach Ansbach und eröffnete dort eine Augenklinik.
Seine Mutter Elise, die aus Witten an der Ruhr stammte, zog 1933 zu ihm.
1934 zogen beide in die Jüdtstraße 20. Dr. Daniels und seine Mutter waren jüdischer Herkunft, fühlten sich aber nicht der jüdischen Religion zugehörig. Sie bezeichneten sich selbst als freireligiös und gehörten keiner jüdischen Gemeinde an.
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Leben für jüdische Menschen immer schwieriger. Auch Dr. Daniels durfte bald nicht mehr offiziell als Arzt arbeiten.
Dennoch behandelte er weiterhin viele Patienten, sogar kostenlos, wenn sie sich die Behandlung nicht leisten konnten.
Als ihm 1938 der Entzug seiner Zulassung als Arzt drohte, floh er gemeinsam mit seiner Mutter nach Hamburg und von dort weiter nach Schweden. Dort durfte er ab 1939 wieder als Augenarzt arbeiten.
In Schweden ließ sich die Familie in der Stadt Helsingborg nieder. Dr. Daniels heiratete eine Schwedin und arbeitete bis ins hohe Alter als Arzt.
Er starb 1982 im Alter von 81 Jahren. Erst spät in seinem Leben setzte er sich wieder mit seiner jüdischen Herkunft auseinander.
Sein Enkel Eric Daniel Zimmermann berichtete später, dass sich sein Großvater immer mehr als Deutscher, denn als Jude gefühlt habe.
Die Stolpersteine erinnern heute an ihr Schicksal und daran, wie schnell sich das Leben durch Ausgrenzung und Verfolgung ändern kann.
Dr. Berthold Daniels wurde 1901 in Hamburg geboren. Er studierte zuerst Mathematik und Physik, wechselte dann zur Medizin und wurde Augenarzt. 1932 zog er nach Ansbach und eröffnete dort eine Augenklinik.
Seine Mutter Elise, die aus Witten an der Ruhr stammte, zog 1933 zu ihm.
1934 zogen beide in die Jüdtstraße 20. Dr. Daniels und seine Mutter waren jüdischer Herkunft, fühlten sich aber nicht der jüdischen Religion zugehörig. Sie bezeichneten sich selbst als freireligiös und gehörten keiner jüdischen Gemeinde an.
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Leben für jüdische Menschen immer schwieriger. Auch Dr. Daniels durfte bald nicht mehr offiziell als Arzt arbeiten.
Dennoch behandelte er weiterhin viele Patienten, sogar kostenlos, wenn sie sich die Behandlung nicht leisten konnten.
Als ihm 1938 der Entzug seiner Zulassung als Arzt drohte, floh er gemeinsam mit seiner Mutter nach Hamburg und von dort weiter nach Schweden. Dort durfte er ab 1939 wieder als Augenarzt arbeiten.
In Schweden ließ sich die Familie in der Stadt Helsingborg nieder. Dr. Daniels heiratete eine Schwedin und arbeitete bis ins hohe Alter als Arzt.
Er starb 1982 im Alter von 81 Jahren. Erst spät in seinem Leben setzte er sich wieder mit seiner jüdischen Herkunft auseinander.
Sein Enkel Eric Daniel Zimmermann berichtete später, dass sich sein Großvater immer mehr als Deutscher, denn als Jude gefühlt habe.
Die Stolpersteine erinnern heute an ihr Schicksal und daran, wie schnell sich das Leben durch Ausgrenzung und Verfolgung ändern kann.
Familie Joel und Flora Schwab
Vor dem Haus in der Nürnberger Straße 22 erinnern heute fünf
Stolpersteine an die jüdische Familie Joel und ihre Verwandte Flora Schwab.
Die Steine wurden am 6. November 2019 und am 11. Februar 2024 verlegt, für Leon Joel, seine Frau Johanna, den gemeinsamen Sohn Günther, Leons Mutter Sara sowie deren Schwester Flora Schwab.
Vielleicht kommt Ihnen der Name Joel bekannt vor, tatsächlich stammt der berühmte Musiker Billy Joel aus dieser Familie. Leons Bruder Karl war sein Großvater.
Leon Joel wurde 1888 in Colmberg geboren. Er war eines von fünf Kindern und zog mit seiner Familie 1895 nach Ansbach.
Dort lebten sie in der Nürnberger Straße 22 und betrieben ein Geschäft für Stoffe, Kurzwaren und Schirme.
Vater Julius starb 1916, Leon übernahm das Geschäft und kämpfte im Ersten Weltkrieg, wofür er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde.
1919 heiratete Leon die aus Unterfranken stammende Johanna Samuel. Zusammen bekamen sie drei Kinder: Marianne, Julius Richard und Günther. Julius starb leider schon im Kindesalter. Tochter Marianne emigrierte mit 14 Jahren nach Schweden, Günther lebte weiterhin mit seinen Eltern und der Großmutter Sara in Ansbach.
Leon engagierte sich stark in der jüdischen Gemeinde und war ab 1936 Gemeindevorsteher. In der Reichspogromnacht im November 1938 wurde er verhaftet und gezwungen, das Haus zu verkaufen. Die Familie floh nach Nürnberg. Dort starb Großmutter Sara im August 1939.
Im Mai 1939 versuchten Leon, Johanna und Günther, mit dem Schiff „St. Louis“ nach Amerika zu fliehen. Doch das Schiff wurde abgewiesen und musste nach Europa zurückkehren.
Die Familie tauchte in Frankreich unter, aber Leon und Johanna wurden 1942 entdeckt und nach Auschwitz deportiert. Beide wurden dort ermordet. Nur Sohn Günther überlebte.
Eine Organisation versteckte ihn in Frankreich, schmuggelte ihn in die Schweiz.
Nach dem Krieg konnte er in die USA auswandern. Er starb 2009 in New York.
Der Stolperstein für Flora Schwab, Leons Tante, wurde im Februar 2024 verlegt. Flora war die jüngere Schwester von Leons Mutter Sara. Sie wurde 1873 geboren und lebte seit 1896 bei der Familie Joel in Ansbach.
Auch sie zog nach den Pogromen mit der Familie nach Nürnberg. Doch ihre Fluchtversuche scheiterten. Flora wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und dort mit 69 Jahren ermordet.
Nach dem Krieg erhielten die überlebenden Kinder der Familie, Marianne und Günther, das Haus in der Nürnberger Straße zurück. Marianne verkaufte es später.
Die Stolpersteine vor dem ehemaligen Wohnhaus erinnern heute an das Schicksal dieser Familie, an Verlust, Flucht, Mut und das Weiterleben ihrer Geschichte.
Die Steine wurden am 6. November 2019 und am 11. Februar 2024 verlegt, für Leon Joel, seine Frau Johanna, den gemeinsamen Sohn Günther, Leons Mutter Sara sowie deren Schwester Flora Schwab.
Vielleicht kommt Ihnen der Name Joel bekannt vor, tatsächlich stammt der berühmte Musiker Billy Joel aus dieser Familie. Leons Bruder Karl war sein Großvater.
Leon Joel wurde 1888 in Colmberg geboren. Er war eines von fünf Kindern und zog mit seiner Familie 1895 nach Ansbach.
Dort lebten sie in der Nürnberger Straße 22 und betrieben ein Geschäft für Stoffe, Kurzwaren und Schirme.
Vater Julius starb 1916, Leon übernahm das Geschäft und kämpfte im Ersten Weltkrieg, wofür er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde.
1919 heiratete Leon die aus Unterfranken stammende Johanna Samuel. Zusammen bekamen sie drei Kinder: Marianne, Julius Richard und Günther. Julius starb leider schon im Kindesalter. Tochter Marianne emigrierte mit 14 Jahren nach Schweden, Günther lebte weiterhin mit seinen Eltern und der Großmutter Sara in Ansbach.
Leon engagierte sich stark in der jüdischen Gemeinde und war ab 1936 Gemeindevorsteher. In der Reichspogromnacht im November 1938 wurde er verhaftet und gezwungen, das Haus zu verkaufen. Die Familie floh nach Nürnberg. Dort starb Großmutter Sara im August 1939.
Im Mai 1939 versuchten Leon, Johanna und Günther, mit dem Schiff „St. Louis“ nach Amerika zu fliehen. Doch das Schiff wurde abgewiesen und musste nach Europa zurückkehren.
Die Familie tauchte in Frankreich unter, aber Leon und Johanna wurden 1942 entdeckt und nach Auschwitz deportiert. Beide wurden dort ermordet. Nur Sohn Günther überlebte.
Eine Organisation versteckte ihn in Frankreich, schmuggelte ihn in die Schweiz.
Nach dem Krieg konnte er in die USA auswandern. Er starb 2009 in New York.
Der Stolperstein für Flora Schwab, Leons Tante, wurde im Februar 2024 verlegt. Flora war die jüngere Schwester von Leons Mutter Sara. Sie wurde 1873 geboren und lebte seit 1896 bei der Familie Joel in Ansbach.
Auch sie zog nach den Pogromen mit der Familie nach Nürnberg. Doch ihre Fluchtversuche scheiterten. Flora wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und dort mit 69 Jahren ermordet.
Nach dem Krieg erhielten die überlebenden Kinder der Familie, Marianne und Günther, das Haus in der Nürnberger Straße zurück. Marianne verkaufte es später.
Die Stolpersteine vor dem ehemaligen Wohnhaus erinnern heute an das Schicksal dieser Familie, an Verlust, Flucht, Mut und das Weiterleben ihrer Geschichte.
Familie Welsch
Vor dem Anwesen Heilig-Kreuz-Straße 13 in Ansbach erinnern heute sechs Stolpersteine an Mitglieder der jüdischen Hopfenhändlerfamilie Welsch und deren Angehörige: Gustav und Gertraud Saemann, Max und Marie Bechhold, Hedwig Hessdörfer und Meta Welsch. Die Geschichten dieser Menschen stehen stellvertretend für das Schicksal vieler jüdischer Familien während der NS-Zeit.
Vier Schwestern der Familie Welsch aus Ottensoos lebten ab den 1930er-Jahren in dem Haus, zwei mit ihren Ehemännern, eine als Witwe und eine ledig. Gertraud war mit Gustav Saemann verheiratet, Marie mit Max Bechhold. Beide Männer waren im Vieh- und Hopfenhandel tätig. Gustav Saemann arbeitete zudem über 30 Jahre lang als Hopfensachverständiger für eine Nürnberger Firma, verlor aber 1935 durch die Arisierung seine Anstellung.
Die Familie Bechhold wohnte bereits ab 1915 in Ansbach. Max Bechhold betrieb im Erdgeschoss des Hauses einen Vieh- und Pferdehandel. 1935 emigrierte seine Frau Marie in die USA zu ihrem Sohn Arnold, ließ ihren Mann aber zurück, möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen. Max verstarb 1937 in Ansbach, ebenso wie seine Schwägerin Hedwig Hessdörfer, die verwitwet im Haus lebte. Beide sind auf dem jüdischen Friedhof der Stadt beerdigt.
Nach der Pogromnacht 1938 wurde das Haus zwangsverkauft, der größte Teil des Kaufpreises ging an die NSDAP. Die noch verbliebenen Bewohner, Gustav und Gertraud Saemann sowie Meta Welsch, mussten das Haus verlassen. Die Saemanns zogen nach Frankfurt am Main, planten die Emigration nach Palästina, doch der Versuch scheiterte. Im November 1941 wurden sie nach Kowno deportiert und dort ermordet.
Meta Welsch, die zeitlebens unverheiratet war, zog Ende 1938 nach Nürnberg und kam später in das Israelitische Altenheim in Würzburg. Sie verstarb dort am 2. Mai 1942, kurz vor einer geplanten Deportation.
Alle sechs Stolpersteine, die am: 28. Juni 2017, 22. März 2023 und 11. Februar 2024 verlegt wurden, erinnern an das Leben und Leiden dieser Menschen. Sie machen sichtbar, wie sehr jüdische Familien durch Entrechtung, Enteignung, Vertreibung und Ermordung zerrissen wurden. Das Haus in der Heilig-Kreuz-Straße 13 war einst ein Zentrum des familiären Zusammenhalts.
Vier Schwestern der Familie Welsch aus Ottensoos lebten ab den 1930er-Jahren in dem Haus, zwei mit ihren Ehemännern, eine als Witwe und eine ledig. Gertraud war mit Gustav Saemann verheiratet, Marie mit Max Bechhold. Beide Männer waren im Vieh- und Hopfenhandel tätig. Gustav Saemann arbeitete zudem über 30 Jahre lang als Hopfensachverständiger für eine Nürnberger Firma, verlor aber 1935 durch die Arisierung seine Anstellung.
Die Familie Bechhold wohnte bereits ab 1915 in Ansbach. Max Bechhold betrieb im Erdgeschoss des Hauses einen Vieh- und Pferdehandel. 1935 emigrierte seine Frau Marie in die USA zu ihrem Sohn Arnold, ließ ihren Mann aber zurück, möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen. Max verstarb 1937 in Ansbach, ebenso wie seine Schwägerin Hedwig Hessdörfer, die verwitwet im Haus lebte. Beide sind auf dem jüdischen Friedhof der Stadt beerdigt.
Nach der Pogromnacht 1938 wurde das Haus zwangsverkauft, der größte Teil des Kaufpreises ging an die NSDAP. Die noch verbliebenen Bewohner, Gustav und Gertraud Saemann sowie Meta Welsch, mussten das Haus verlassen. Die Saemanns zogen nach Frankfurt am Main, planten die Emigration nach Palästina, doch der Versuch scheiterte. Im November 1941 wurden sie nach Kowno deportiert und dort ermordet.
Meta Welsch, die zeitlebens unverheiratet war, zog Ende 1938 nach Nürnberg und kam später in das Israelitische Altenheim in Würzburg. Sie verstarb dort am 2. Mai 1942, kurz vor einer geplanten Deportation.
Alle sechs Stolpersteine, die am: 28. Juni 2017, 22. März 2023 und 11. Februar 2024 verlegt wurden, erinnern an das Leben und Leiden dieser Menschen. Sie machen sichtbar, wie sehr jüdische Familien durch Entrechtung, Enteignung, Vertreibung und Ermordung zerrissen wurden. Das Haus in der Heilig-Kreuz-Straße 13 war einst ein Zentrum des familiären Zusammenhalts.
Familien Kohn, Seeberger und Stefansky
Vor dem Haus Schalkhäuser Straße 21 wurden am 21. Juli 2021 sieben
Stolpersteine für Angehörige der Familien Kohn, Seeberger und Stefansky
verlegt:
Von 1894 bis 1915 und erneut von 1937 bis zur Zerschlagung der Gemeinde nach dem Novemberpogrom 1938 war er Rabbiner in Ansbach und leitete das gesamte Distriktsrabbinat.
Weltweit wurde er zudem als Mitbegründer und führender Kopf der orthodoxen Organisation „Agudat Israel“ bekannt.
Geboren wurde Pinchas Kohn am 27. Februar 1867 im schwäbischen Kleinerdlingen (Kreis Donau-Ries) in eine traditionsreiche Rabbinerfamilie. Sein Vater Marx Michael Kohn war ebenfalls Rabbiner, ebenso sein Großvater mütterlicherseits, Rabbiner David Weiskopf.
Nach dem Abitur erhielt Pinchas Kohn eine umfassende rabbinische Ausbildung in Berlin, studierte zudem Philologie und Philosophie und eignete sich Kenntnisse in Sanskrit an. Nach einer kurzen Rabbinerstelle in Mannheim und der Promotion in Bern wurde er 1894 zum Rabbiner des Distriktsrabbinats Ansbach gewählt.
1896 heiratete er Rosalie Moses aus Frankfurt am Main. Gemeinsam hatten sie vier Kinder: Franziska (geboren 1898), Moses (1899), Hannah (1909) und Zipora (1914).
Bis zum Ersten Weltkrieg blieb Kohn der Ansbacher Gemeinde treu und lehnte Angebote aus größeren Städten ab.
Als orthodoxer Rabbiner war er 1912 an der Gründung von „Agudat Israel“ beteiligt und wurde 1923 deren Präsident. Für diese Aufgabe lebte er zeitweise in Wien und beriet hohe europäische Politiker.
Anfang der 1930er Jahre kehrte Kohn nach Ansbach zurück. Er war eng befreundet mit Rabbiner Dr. Eli Munk und trat 1937 dessen Nachfolge an, wurde somit der letzte Rabbiner der Gemeinde.
Trotz wiederholter Aufforderungen zur Emigration blieb er bis zu seiner Ausweisung Ende 1938 in Ansbach. Das Novemberpogrom und die Zerstörung der Synagoge musste er schmerzhaft miterleben.
Ende 1938 floh Pinchas Kohn gemeinsam mit seiner Frau zunächst nach Basel zu Tochter Zipora, dann weiter nach London zu Tochter Hannah.
Im April 1939 emigrierte er nach Israel. Dort erfüllte sich sein Wunsch, seine letzten Lebensjahre in Jerusalem zu verbringen und auf dem Ölberg bestattet zu werden.
Er starb am 2. Juli 1941 im Alter von 74 Jahren. Rosalie Kohn verstarb 1965 in Basel und wurde ebenfalls in Jerusalem beigesetzt.
Die Tochter Franziska Seeberger floh bereits 1935 mit ihrem Mann Josef und den beiden Söhnen Siegfried und Rudolf nach Israel, wo sie 1967 starb. Tochter Hannah (später Levy) verließ Ansbach schon früh, studierte in Köln, Krakau, Wien und Berlin und konnte 1939 nach London fliehen, wo sie als Lehrerin und Schulleiterin arbeitete. Sie lebte später in Israel und starb dort 2003.
Sohn Moses Kohn, der als Gärtner ausgebildet war, zog 1926 nach Walsdorf bei Bamberg. 1942 wurde er von dort deportiert und im Vernichtungslager Majdanek ermordet.
Zipora Kohn wanderte in die Schweiz aus, heiratete Ephraim Stefansky und erhielt die Schweizer Staatsangehörigkeit. Sie lebte mit ihrer Familie in Basel und verstarb dort im Jahr 2004.
Die Stolpersteine vor der Schalkhäuser Straße 21 erinnern an das Schicksal dieser eng verbundenen Familien, die durch Verfolgung und Flucht auseinandergerissen wurden.
- Rabbiner Dr. phil. Pinchas Kohn und seine Frau Rosalie, geb. Moses,
- deren Tochter Franziska Seeberger, geb. Kohn, mit ihrem Ehemann Josef und den Söhnen Siegfried und Rudolf,
- sowie für Zipora Stefansky, geb. Kohn, eine weitere Tochter von Pinchas und Rosalie.
Von 1894 bis 1915 und erneut von 1937 bis zur Zerschlagung der Gemeinde nach dem Novemberpogrom 1938 war er Rabbiner in Ansbach und leitete das gesamte Distriktsrabbinat.
Weltweit wurde er zudem als Mitbegründer und führender Kopf der orthodoxen Organisation „Agudat Israel“ bekannt.
Geboren wurde Pinchas Kohn am 27. Februar 1867 im schwäbischen Kleinerdlingen (Kreis Donau-Ries) in eine traditionsreiche Rabbinerfamilie. Sein Vater Marx Michael Kohn war ebenfalls Rabbiner, ebenso sein Großvater mütterlicherseits, Rabbiner David Weiskopf.
Nach dem Abitur erhielt Pinchas Kohn eine umfassende rabbinische Ausbildung in Berlin, studierte zudem Philologie und Philosophie und eignete sich Kenntnisse in Sanskrit an. Nach einer kurzen Rabbinerstelle in Mannheim und der Promotion in Bern wurde er 1894 zum Rabbiner des Distriktsrabbinats Ansbach gewählt.
1896 heiratete er Rosalie Moses aus Frankfurt am Main. Gemeinsam hatten sie vier Kinder: Franziska (geboren 1898), Moses (1899), Hannah (1909) und Zipora (1914).
Bis zum Ersten Weltkrieg blieb Kohn der Ansbacher Gemeinde treu und lehnte Angebote aus größeren Städten ab.
Als orthodoxer Rabbiner war er 1912 an der Gründung von „Agudat Israel“ beteiligt und wurde 1923 deren Präsident. Für diese Aufgabe lebte er zeitweise in Wien und beriet hohe europäische Politiker.
Anfang der 1930er Jahre kehrte Kohn nach Ansbach zurück. Er war eng befreundet mit Rabbiner Dr. Eli Munk und trat 1937 dessen Nachfolge an, wurde somit der letzte Rabbiner der Gemeinde.
Trotz wiederholter Aufforderungen zur Emigration blieb er bis zu seiner Ausweisung Ende 1938 in Ansbach. Das Novemberpogrom und die Zerstörung der Synagoge musste er schmerzhaft miterleben.
Ende 1938 floh Pinchas Kohn gemeinsam mit seiner Frau zunächst nach Basel zu Tochter Zipora, dann weiter nach London zu Tochter Hannah.
Im April 1939 emigrierte er nach Israel. Dort erfüllte sich sein Wunsch, seine letzten Lebensjahre in Jerusalem zu verbringen und auf dem Ölberg bestattet zu werden.
Er starb am 2. Juli 1941 im Alter von 74 Jahren. Rosalie Kohn verstarb 1965 in Basel und wurde ebenfalls in Jerusalem beigesetzt.
Die Tochter Franziska Seeberger floh bereits 1935 mit ihrem Mann Josef und den beiden Söhnen Siegfried und Rudolf nach Israel, wo sie 1967 starb. Tochter Hannah (später Levy) verließ Ansbach schon früh, studierte in Köln, Krakau, Wien und Berlin und konnte 1939 nach London fliehen, wo sie als Lehrerin und Schulleiterin arbeitete. Sie lebte später in Israel und starb dort 2003.
Sohn Moses Kohn, der als Gärtner ausgebildet war, zog 1926 nach Walsdorf bei Bamberg. 1942 wurde er von dort deportiert und im Vernichtungslager Majdanek ermordet.
Zipora Kohn wanderte in die Schweiz aus, heiratete Ephraim Stefansky und erhielt die Schweizer Staatsangehörigkeit. Sie lebte mit ihrer Familie in Basel und verstarb dort im Jahr 2004.
Die Stolpersteine vor der Schalkhäuser Straße 21 erinnern an das Schicksal dieser eng verbundenen Familien, die durch Verfolgung und Flucht auseinandergerissen wurden.
Familie Weissmann
Am 6. November 2019 wurden vor dem früheren Haus
Schloßstraße 13 in Ansbach vier Stolpersteine verlegt, für Jakob und Martha
Weissmann sowie ihre Kinder Martin und Helga.
Wo sich heute das Hotel „Hürner“ befindet, stand früher das Wohnhaus der Familie Weissmann.
Jakob Weissmann stammte aus einer großen Viehhändlerfamilie aus Egenhausen und wurde 1877 geboren.
1912 heiratete er Martha Laub, die aus Thüringen kam.
Kurz nach der Hochzeit zog das Paar nach Ansbach in die Schloßstraße. Dort wurden auch ihre beiden Kinder geboren: Martin im Jahr 1913 und Helga 1919.
Jakob Weissmann arbeitete als Landmaschinenhändler und war geschäftlich sehr erfolgreich. Er besaß mehrere Grundstücke und Lagerhallen in Ansbach und war aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde.
Sohn Martin zog schon mit 19 Jahren nach Würzburg, wo er als Apotheker arbeitete.
1938 konnte er rechtzeitig nach Palästina fliehen.
Tochter Helga war während der 1930er Jahre als Lehrmädchen unterwegs, kehrte aber 1938 zu ihren Eltern nach Ansbach zurück.
In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 erlebten Jakob, Martha und Helga die Gewalt der Nationalsozialisten hautnah. Wenig später mussten sie ihr Haus und alle Besitztümer verkaufen.
Am 7. Dezember 1938 floh die Familie nach München. Dort planten sie, ebenfalls nach Palästina zu fliehen, doch nur Helga gelang die Ausreise, und zwar im Mai 1939 nach Edinburgh in Schottland. Die Eltern blieben zurück.
Am 4. April 1942 wurden Jakob und Martha Weissmann nach Piaski (im heutigen Polen) deportiert und dort ermordet.
Nach dem Krieg meldeten Martin und Helga Entschädigungsansprüche an.
1951 wurde der Besitz der Familie an Martin zurückübertragen.
Martin starb 1985 in Israel. Helga lebte bis zu ihrem Tod 1984 in den USA, wo sie verheiratet war und den Namen Zeltsman trug.
Beide Kinder gründeten eigene Familien, so bleibt die Erinnerung an die Familie Weissmann bis heute lebendig.
Wo sich heute das Hotel „Hürner“ befindet, stand früher das Wohnhaus der Familie Weissmann.
Jakob Weissmann stammte aus einer großen Viehhändlerfamilie aus Egenhausen und wurde 1877 geboren.
1912 heiratete er Martha Laub, die aus Thüringen kam.
Kurz nach der Hochzeit zog das Paar nach Ansbach in die Schloßstraße. Dort wurden auch ihre beiden Kinder geboren: Martin im Jahr 1913 und Helga 1919.
Jakob Weissmann arbeitete als Landmaschinenhändler und war geschäftlich sehr erfolgreich. Er besaß mehrere Grundstücke und Lagerhallen in Ansbach und war aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde.
Sohn Martin zog schon mit 19 Jahren nach Würzburg, wo er als Apotheker arbeitete.
1938 konnte er rechtzeitig nach Palästina fliehen.
Tochter Helga war während der 1930er Jahre als Lehrmädchen unterwegs, kehrte aber 1938 zu ihren Eltern nach Ansbach zurück.
In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 erlebten Jakob, Martha und Helga die Gewalt der Nationalsozialisten hautnah. Wenig später mussten sie ihr Haus und alle Besitztümer verkaufen.
Am 7. Dezember 1938 floh die Familie nach München. Dort planten sie, ebenfalls nach Palästina zu fliehen, doch nur Helga gelang die Ausreise, und zwar im Mai 1939 nach Edinburgh in Schottland. Die Eltern blieben zurück.
Am 4. April 1942 wurden Jakob und Martha Weissmann nach Piaski (im heutigen Polen) deportiert und dort ermordet.
Nach dem Krieg meldeten Martin und Helga Entschädigungsansprüche an.
1951 wurde der Besitz der Familie an Martin zurückübertragen.
Martin starb 1985 in Israel. Helga lebte bis zu ihrem Tod 1984 in den USA, wo sie verheiratet war und den Namen Zeltsman trug.
Beide Kinder gründeten eigene Familien, so bleibt die Erinnerung an die Familie Weissmann bis heute lebendig.
Familie Stühler
Vor dem Haus Oberhäuserstraße 19 wurden am 17. Juli 2018 die ersten drei
Stolpersteine für die Familie Stühler verlegt, die dort bis 1936 lebte.
Die Stolpersteine erinnern an das Ehepaar Max und Lina Stühler sowie ihren Sohn Martin.
Max Stühler wurde am 8. Februar 1891 in Untererthal bei Hammelburg geboren.
Er war Sohn des Handelsmannes Meir Stühler und seiner Frau Helena, geborene Schlossberger. Seine Ehefrau Lina, geborene Karolina Liebenstein, kam am 18. Juli 1884 in Hüttenheim bei Kitzingen zur Welt. Sie war Tochter des Handelsmannes Ephraim Liebenstein und seiner Frau Hanna, geborene Baer. Max und Lina heirateten am 17. Februar 1920 in Ansbach.
Ihr einziger Sohn Martin wurde am 13. Oktober 1921 geboren.
Max Stühler, dessen Berufe in den Ansbacher Archiven als „Viehhändler“ und „Metzgermeister“ verzeichnet sind, betrieb in der Oberhäuserstraße 19 eine Metzgerei mit Ladengeschäft. Das Haus gehörte dem Stukkateurmeister Josef Wagner, der ebenfalls dort wohnte.
Im Ansbacher Adressbuch wird Max Stühler als Ochsen-, Rind- und Schweinemetzger geführt.
Die zunehmenden Repressalien der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren zerstörten die wirtschaftliche Basis der Familie.
In einem Hetzblatt von 1936 wurde dazu aufgerufen, keine jüdischen Geschäfte zu besuchen, darunter war auch die Metzgerei von Max Stühler namentlich genannt.
Im September 1936 verließ Max Stühler mit seiner sieben Jahre älteren Ehefrau Lina und dem 15-jährigen Sohn Martin die Stadt Ansbach, um in den USA Schutz zu suchen. Sie reisten mit dem Schiff „Berengaria“ vom Hafen Cherbourg in der Normandie ab und erreichten sechs Tage später New York.
Um die Metzgereilizenz nicht zu verlieren, suchte der Hauseigentümer Josef Wagner dringend einen Nachfolger für das Geschäft. Er fand ihn in der Familie Hoch aus Jagstheim, die nach Ansbach zog und die Metzgerei wieder eröffnete.
Jahrzehnte später gab die Familie Hoch das Geschäft auf und verlegte ihren Betrieb einige Häuser weiter auf die gegenüberliegende Straßenseite. Die Familie Stühler ließ sich in Manhattan, New York, nieder. Max arbeitete dort erneut als Metzger, während sein Sohn Martin Ende der 1930er Jahre Dienst in der U.S. Army leistete.
Verwandte von Max Stühler gehörten zu den letzten jüdischen Bewohnern seines Geburtsortes Untererthal, die dort bis 1942 lebten.
Nach dem Krieg blieb die Familie Stühler im Raum New York. Max Stühler starb im Oktober 1968 im Alter von 77 Jahren in New York. Sohn Martin gründete eine Familie, hatte mit seiner Frau Norma zwei Töchter und verstarb am 26. April 2014 im Alter von 92 Jahren in Kingston, Staat New York.
Die Stolpersteine erinnern an das Ehepaar Max und Lina Stühler sowie ihren Sohn Martin.
Max Stühler wurde am 8. Februar 1891 in Untererthal bei Hammelburg geboren.
Er war Sohn des Handelsmannes Meir Stühler und seiner Frau Helena, geborene Schlossberger. Seine Ehefrau Lina, geborene Karolina Liebenstein, kam am 18. Juli 1884 in Hüttenheim bei Kitzingen zur Welt. Sie war Tochter des Handelsmannes Ephraim Liebenstein und seiner Frau Hanna, geborene Baer. Max und Lina heirateten am 17. Februar 1920 in Ansbach.
Ihr einziger Sohn Martin wurde am 13. Oktober 1921 geboren.
Max Stühler, dessen Berufe in den Ansbacher Archiven als „Viehhändler“ und „Metzgermeister“ verzeichnet sind, betrieb in der Oberhäuserstraße 19 eine Metzgerei mit Ladengeschäft. Das Haus gehörte dem Stukkateurmeister Josef Wagner, der ebenfalls dort wohnte.
Im Ansbacher Adressbuch wird Max Stühler als Ochsen-, Rind- und Schweinemetzger geführt.
Die zunehmenden Repressalien der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren zerstörten die wirtschaftliche Basis der Familie.
In einem Hetzblatt von 1936 wurde dazu aufgerufen, keine jüdischen Geschäfte zu besuchen, darunter war auch die Metzgerei von Max Stühler namentlich genannt.
Im September 1936 verließ Max Stühler mit seiner sieben Jahre älteren Ehefrau Lina und dem 15-jährigen Sohn Martin die Stadt Ansbach, um in den USA Schutz zu suchen. Sie reisten mit dem Schiff „Berengaria“ vom Hafen Cherbourg in der Normandie ab und erreichten sechs Tage später New York.
Um die Metzgereilizenz nicht zu verlieren, suchte der Hauseigentümer Josef Wagner dringend einen Nachfolger für das Geschäft. Er fand ihn in der Familie Hoch aus Jagstheim, die nach Ansbach zog und die Metzgerei wieder eröffnete.
Jahrzehnte später gab die Familie Hoch das Geschäft auf und verlegte ihren Betrieb einige Häuser weiter auf die gegenüberliegende Straßenseite. Die Familie Stühler ließ sich in Manhattan, New York, nieder. Max arbeitete dort erneut als Metzger, während sein Sohn Martin Ende der 1930er Jahre Dienst in der U.S. Army leistete.
Verwandte von Max Stühler gehörten zu den letzten jüdischen Bewohnern seines Geburtsortes Untererthal, die dort bis 1942 lebten.
Nach dem Krieg blieb die Familie Stühler im Raum New York. Max Stühler starb im Oktober 1968 im Alter von 77 Jahren in New York. Sohn Martin gründete eine Familie, hatte mit seiner Frau Norma zwei Töchter und verstarb am 26. April 2014 im Alter von 92 Jahren in Kingston, Staat New York.
Dokumentationszentrum Nürnberg
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände
Das „Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“ in Nürnberg zählt zu den wichtigsten Lern- und Erinnerungsorten der NS- Geschichte in Deutschland. Was einst als Bühne für die Machtdemonstrationen der NSDAP diente, ist heute ein Zentrum der kritischen Auseinandersetzung mit den Ideologien und Strukturen nationalsozialistischer Gewalt.
Das Angebot des Museums richtet sich unter anderem an junge Menschen, um historisches Bewusstsein zu fördern und ein Verständnis für die Bedeutung demokratischer Prinzipien in der heutigen Zeit zu entwickeln.
Das Angebot des Museums richtet sich unter anderem an junge Menschen, um historisches Bewusstsein zu fördern und ein Verständnis für die Bedeutung demokratischer Prinzipien in der heutigen Zeit zu entwickeln.
PD Dr. Imanuel BaumannLeiter „Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“
Imanuel Baumann ist Leiter des „Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände“ in Nürnberg sowie der Abteilung „Erinnerungskultur und Zeitgeschichte“. Als habilitierter Historiker mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Gedenkstättenarbeit beschäftigt er sich intensiv mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und ihrer Vermittlung.
Zentral ist für ihn die Frage, wie Erinnerungskultur heute so entwickelt werden kann, dass sie über die reine Vermittlung von Fakten hinausgeht und eine kritische, offene Auseinandersetzung mit der Geschichte und ihren Auswirkungen auf unsere heutige Gesellschaft fördert. Unter seiner Leitung verbindet das Dokumentationszentrum wissenschaftliche Forschung mit innovativen Vermittlungsformaten und versteht sich als zukunftsorientierter Ort des gesellschaftlichen Lernens.
Zentral ist für ihn die Frage, wie Erinnerungskultur heute so entwickelt werden kann, dass sie über die reine Vermittlung von Fakten hinausgeht und eine kritische, offene Auseinandersetzung mit der Geschichte und ihren Auswirkungen auf unsere heutige Gesellschaft fördert. Unter seiner Leitung verbindet das Dokumentationszentrum wissenschaftliche Forschung mit innovativen Vermittlungsformaten und versteht sich als zukunftsorientierter Ort des gesellschaftlichen Lernens.
Aktuelle Ausstellung
Das „Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“ in Nürnberg befindet sich derzeit in einer umfassenden Neugestaltung. Um die wichtige Vermittlungsarbeit zur Geschichte des Nationalsozialismus auch während der Bauphase fortzuführen, wurde eine Interimsausstellung, also eine Übergangsausstellung mit dem Titel „Nürnberg – Ort der Reichsparteitage“, eingerichtet. Diese kleinere Exposition ermöglicht weiterhin einen Besuch vor Ort und trägt zur Aufrechterhaltung der Bildungsarbeit bei.
Vor der Neukonzeption zählte das Zentrum jährlich rund 300.000 Gäste. Aktuell besuchen etwa 170.000 Personen pro Jahr die verkleinerte Ausstellung, trotz einschränkender Bedingungen und laufender Bauarbeiten. Für die Verantwortlichen ist diese Entwicklung ein Indikator dafür, dass auch in der Übergangszeit ein großes Interesse an der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte besteht. Gleichzeitig wird deutlich, welches Potenzial die zukünftige, erweiterte Ausstellung bieten kann.
Vor der Neukonzeption zählte das Zentrum jährlich rund 300.000 Gäste. Aktuell besuchen etwa 170.000 Personen pro Jahr die verkleinerte Ausstellung, trotz einschränkender Bedingungen und laufender Bauarbeiten. Für die Verantwortlichen ist diese Entwicklung ein Indikator dafür, dass auch in der Übergangszeit ein großes Interesse an der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte besteht. Gleichzeitig wird deutlich, welches Potenzial die zukünftige, erweiterte Ausstellung bieten kann.
Wir haben mit dem Leiter des Museums ein längeres Gespräch geführt. Wenn Sie mehr Infos zu ihm und seiner Arbeit mit der Erinnerungskultur erhalten wollen, lesen Sie das vollständige Interview, welches im nächsten Abschnitt folgt. Interview PD Dr. Imanuel Baumann
Wir haben mit dem Leiter des Museums ein längeres Gespräch geführt. Wenn Sie mehr Infos zu ihm und seiner Arbeit mit der Erinnerungskultur erhalten wollen, lesen Sie das vollständige Interview, welches im nächsten Abschnitt folgt. Interview PD Dr. Imanuel Baumann
Vollbild
Welche Rolle spielt „Generationenübergreifende Erinnerung“ in Zeiten schwindender Zeitzeugenschaft?
Es gibt kaum mehr Generationenbezüge, also biografische Bezüge. Die Menschen, die in den 70er Jahren vielleicht auch noch in den 80ern klein waren, kennen es noch, wenn alte Männer nur mit einem Bein durchs Dorf oder durch die Stadt gehumpelt sind, weil sie das andere im Krieg verloren hatten. Das gibt es heute so nicht mehr. 80 Jahre ist nach Aleida Assmann, Kulturwissenschaftlerin, der Zeitraum, in der persönliche Erinnerungen noch weitergegeben werden können. Für junge Menschen von heute ist das unglaublich weit weg. Da drängt sich die Frage „Was hat das mit mir zu tun?“ mehr auf denn je. Die Frage ist meiner Meinung nach für alle Altersgruppen von großer Bedeutung. Auch unabhängig davon, ob Menschen schon seit Generationen mit ihren Familien in Deutschland leben oder gerade erst zugewandert sind.
Wie versuchen Sie Besucherinnen und Besucher nicht nur zu informieren, sondern auch zur Reflexion von Mechanismen vergangener Ideologie anzuregen und wie wollen Sie die Aspekte in Ihre neukonzeptionierte Ausstellung integrieren?
Wir wollen über unsere personale Vermittlung mit dem Publikum ins Gespräch kommen und somit die reflexive Ebene bedienen. Mir ist dabei wichtig, dass diese „Museums-Gespräche“ nicht nur von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgehen und belehrend sind, sondern zu einem Dialog mit den Besucherinnen und Besuchern führen, also im direkten Austausch mit ihnen stattfindet. In unserer künftigen Ausstellung wollen wir reflexive Fragestellungen weitaus mehr einbeziehen, als das bisher der Fall ist. Zum Beispiel, wenn wir über NS-Propaganda sprechen. Mögliche Fragen wären in dem Zusammenhang, wie Bilder zu der damaligen Zeit inszeniert, wie sie aufgebaut worden sind, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen – in Anlehnung an den Propaganda-Film „Triumph des Willens“ von Leni Riefenstahl. Und das dann wiederum in einen aktuellen Kontext mit beispielsweise „Fake News“ und „Framing“ zu setzten. In der neuen Ausstellung werden sich partizipative Elemente durch die gesamte Exposition ziehen.
Wie beeinflusst „Künstliche Intelligenz“ und deren Manipulationspotenzial die Arbeitsweise eines Museums im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit?
Die schnelllebigen technischen Veränderungen und Entwicklungen der „Künstlichen Intelligenz“ werden dazu führen, dass uns künftig Besucherinnen und Besucher fragen werden „Ist es denn wahr, was ihr uns erzählt?“. Deshalb setzten wir besonders darauf, wissenschaftsorientiert zu arbeiten. Verwendete Quellen zu belegen, indem wir Archiv-Nachweise unter unseren Ausstellungsstücken anbringen. Wir machen dadurch transparent, aus welchen Quellen wir unser Narrativ, unsere Erzählung ableiten, um diesen Prozess für unsere Gäste nachvollziehbar zu machen. Jemand, der allerdings die Meinung vertritt, auch diese Quellen, die in Archiven liegen, seien alle erfunden und gefaked, wird sich schwer vom Gegenteil überzeugen lassen, weil eine gemeinsame Verständnis-Basis fehlt. Aber Menschen, die das immerhin zugestehen, mit denen kann man darüber ins Gespräch kommen. Das sind Aspekte, die uns in der Zukunft in Verbindung mit der „Austauschkultur“ und mit KI noch weiter beschäftigen werden.
Welche Rolle spielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen heute noch in Gedenkstätten und wie bereichern sie die pädagogische Arbeit?
Der Alltag der Gedenkstätten sah schon seit Jahrzehnten so aus, dass man sich auf die Zeit nach der Zeitzeugenschaft ausgerichtet hat. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben demnach in der praktischen Arbeit mit Museen nicht mehr die Hauptrolle gespielt. Eine Zusammenarbeit mit ihnen war eher eine Ausnahme, wenn beispielsweise „Schüler-Gespräche“ stattgefunden haben. Sie sind für den Bereich der Pädagogik eine enorme Bereicherung, denn: Zeitzeuginnen und Zeitzeugen besitzen eine ethische Kraft, wenn sie sich zu aktuellen Entwicklungen äußern und positionieren. Sie taten und tun das mit einer besonderen Autorität. Wir werden sie als Menschen und ihr ethisches Wirken sehr schmerzlich vermissen, wenn es sie in den kommenden Jahren nicht mehr geben wird.
Inwiefern kann digitale Technik wie „Augmented Reality“ traditionelle Formen der „Erinnerungskultur“ ergänzen und wo sollte eine klare Grenze gezogen werden?
„Augmented Reality“ kann uns dabei helfen, in Bereiche vorzudringen, die wir bisher nicht gut bedienen können. Ein gutes Beispiel dafür ist die „Gedenkstätte Wolfenbüttel“. Sie befindet sich auf dem Justizvollzugsanstaltsgelände, welches heute noch in Betrieb ist. Die Sicht auf den damaligen Hinrichtungsplatz ist eingeschränkt, weil die Gefängnisinsassen Hofgang haben und dieser deshalb von Besucherinnen und Besuchern nicht eingesehen werden darf. Daher ist das Fenster mit der Sichtachse zu dem Hinrichtungsplatz opak. Der Ort könnte mithilfe eines Tablets und „Augmented Reality“ begehbar gemacht werden. Wir sollten allerdings vermeiden, mit der uns zu Verfügung stehenden Technik den Bereich des Fiktionalen zu betreten. Ich bin eher ein Kritiker von Accounts wie „Ich bin Sophie Scholl“ oder auch von (KI-generierten) Hologrammen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Wir sollten die Zeugnisse, die sie uns hinterlassen (haben) genauso quellenkritisch wie andere Inhalte aufbereiten. Als Gesellschaft müssen wir akzeptieren, dass Überlebende des NS-Regimes wie Margot Friedländer neulich mit über 100 Jahren von uns gehen. Wir müssen ihr Erbe lebendig halten, aber nicht indem wir Hologramme schaffen, sondern indem wir besprechen und diskutieren, was sie hinterlassen haben.
Es gibt kaum mehr Generationenbezüge, also biografische Bezüge. Die Menschen, die in den 70er Jahren vielleicht auch noch in den 80ern klein waren, kennen es noch, wenn alte Männer nur mit einem Bein durchs Dorf oder durch die Stadt gehumpelt sind, weil sie das andere im Krieg verloren hatten. Das gibt es heute so nicht mehr. 80 Jahre ist nach Aleida Assmann, Kulturwissenschaftlerin, der Zeitraum, in der persönliche Erinnerungen noch weitergegeben werden können. Für junge Menschen von heute ist das unglaublich weit weg. Da drängt sich die Frage „Was hat das mit mir zu tun?“ mehr auf denn je. Die Frage ist meiner Meinung nach für alle Altersgruppen von großer Bedeutung. Auch unabhängig davon, ob Menschen schon seit Generationen mit ihren Familien in Deutschland leben oder gerade erst zugewandert sind.
Wie versuchen Sie Besucherinnen und Besucher nicht nur zu informieren, sondern auch zur Reflexion von Mechanismen vergangener Ideologie anzuregen und wie wollen Sie die Aspekte in Ihre neukonzeptionierte Ausstellung integrieren?
Wir wollen über unsere personale Vermittlung mit dem Publikum ins Gespräch kommen und somit die reflexive Ebene bedienen. Mir ist dabei wichtig, dass diese „Museums-Gespräche“ nicht nur von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgehen und belehrend sind, sondern zu einem Dialog mit den Besucherinnen und Besuchern führen, also im direkten Austausch mit ihnen stattfindet. In unserer künftigen Ausstellung wollen wir reflexive Fragestellungen weitaus mehr einbeziehen, als das bisher der Fall ist. Zum Beispiel, wenn wir über NS-Propaganda sprechen. Mögliche Fragen wären in dem Zusammenhang, wie Bilder zu der damaligen Zeit inszeniert, wie sie aufgebaut worden sind, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen – in Anlehnung an den Propaganda-Film „Triumph des Willens“ von Leni Riefenstahl. Und das dann wiederum in einen aktuellen Kontext mit beispielsweise „Fake News“ und „Framing“ zu setzten. In der neuen Ausstellung werden sich partizipative Elemente durch die gesamte Exposition ziehen.
Wie beeinflusst „Künstliche Intelligenz“ und deren Manipulationspotenzial die Arbeitsweise eines Museums im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit?
Die schnelllebigen technischen Veränderungen und Entwicklungen der „Künstlichen Intelligenz“ werden dazu führen, dass uns künftig Besucherinnen und Besucher fragen werden „Ist es denn wahr, was ihr uns erzählt?“. Deshalb setzten wir besonders darauf, wissenschaftsorientiert zu arbeiten. Verwendete Quellen zu belegen, indem wir Archiv-Nachweise unter unseren Ausstellungsstücken anbringen. Wir machen dadurch transparent, aus welchen Quellen wir unser Narrativ, unsere Erzählung ableiten, um diesen Prozess für unsere Gäste nachvollziehbar zu machen. Jemand, der allerdings die Meinung vertritt, auch diese Quellen, die in Archiven liegen, seien alle erfunden und gefaked, wird sich schwer vom Gegenteil überzeugen lassen, weil eine gemeinsame Verständnis-Basis fehlt. Aber Menschen, die das immerhin zugestehen, mit denen kann man darüber ins Gespräch kommen. Das sind Aspekte, die uns in der Zukunft in Verbindung mit der „Austauschkultur“ und mit KI noch weiter beschäftigen werden.
Welche Rolle spielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen heute noch in Gedenkstätten und wie bereichern sie die pädagogische Arbeit?
Der Alltag der Gedenkstätten sah schon seit Jahrzehnten so aus, dass man sich auf die Zeit nach der Zeitzeugenschaft ausgerichtet hat. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben demnach in der praktischen Arbeit mit Museen nicht mehr die Hauptrolle gespielt. Eine Zusammenarbeit mit ihnen war eher eine Ausnahme, wenn beispielsweise „Schüler-Gespräche“ stattgefunden haben. Sie sind für den Bereich der Pädagogik eine enorme Bereicherung, denn: Zeitzeuginnen und Zeitzeugen besitzen eine ethische Kraft, wenn sie sich zu aktuellen Entwicklungen äußern und positionieren. Sie taten und tun das mit einer besonderen Autorität. Wir werden sie als Menschen und ihr ethisches Wirken sehr schmerzlich vermissen, wenn es sie in den kommenden Jahren nicht mehr geben wird.
Inwiefern kann digitale Technik wie „Augmented Reality“ traditionelle Formen der „Erinnerungskultur“ ergänzen und wo sollte eine klare Grenze gezogen werden?
„Augmented Reality“ kann uns dabei helfen, in Bereiche vorzudringen, die wir bisher nicht gut bedienen können. Ein gutes Beispiel dafür ist die „Gedenkstätte Wolfenbüttel“. Sie befindet sich auf dem Justizvollzugsanstaltsgelände, welches heute noch in Betrieb ist. Die Sicht auf den damaligen Hinrichtungsplatz ist eingeschränkt, weil die Gefängnisinsassen Hofgang haben und dieser deshalb von Besucherinnen und Besuchern nicht eingesehen werden darf. Daher ist das Fenster mit der Sichtachse zu dem Hinrichtungsplatz opak. Der Ort könnte mithilfe eines Tablets und „Augmented Reality“ begehbar gemacht werden. Wir sollten allerdings vermeiden, mit der uns zu Verfügung stehenden Technik den Bereich des Fiktionalen zu betreten. Ich bin eher ein Kritiker von Accounts wie „Ich bin Sophie Scholl“ oder auch von (KI-generierten) Hologrammen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Wir sollten die Zeugnisse, die sie uns hinterlassen (haben) genauso quellenkritisch wie andere Inhalte aufbereiten. Als Gesellschaft müssen wir akzeptieren, dass Überlebende des NS-Regimes wie Margot Friedländer neulich mit über 100 Jahren von uns gehen. Wir müssen ihr Erbe lebendig halten, aber nicht indem wir Hologramme schaffen, sondern indem wir besprechen und diskutieren, was sie hinterlassen haben.
Stadt Ansbach
Archiv-Bilder
Die Spuren der Vergangenheit sind oft unscheinbar. Verborgen in Straßenzügen, Gebäuden oder alten Fotografien. In diesem Erzählstrang laden wir dazu ein, durch Bilder aus dem Stadtarchiv Ansbach einen Blick auf die Erinnerungskultur der Stadt zu werfen.
Geschichte für ALLE e.V.
Dr. Pascal MetzgerWissenschaftlicher Mitarbeiter bei „GESCHICHTE FÜR ALLE e.V.“
Pascal Metzger ist Historiker und seit 18 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter bei „GESCHICHTE FÜR ALLE e.V.“. Dort ist er zuständig für den Bereich „Erinnerungskultur“. Der gemeinnützige Verein engagiert sich im Raum Nürnberg, Fürth, Erlangen und Bamberg für die Vermittlung von Geschichte: Unter anderem durch historische Stadtführungen, Publikationen zur Stadt- und Regionalgeschichte sowie Bildungsangebote für Schülerinnen, Schüler und Studierende zur NS-Zeit.
Neben seinen wissenschaftlichen Tätigkeiten koordiniert Metzger in Nürnberg die Verlegung der „Stolpersteine“. Ein dezentrales, internationales Erinnerungsprojekt des Künstlers Gunter Demnig. Dabei werden Namen und Schicksale von NS-Verfolgten in Messingtafeln graviert und vor ihren letzten Wohnorten in den Boden eingelassen. So wird Erinnerung dort sichtbar gemacht, wo diese Menschen einst lebten. Für Angehörige entsteht ein Ort des Gedenkens und der Trauer.
Neben seinen wissenschaftlichen Tätigkeiten koordiniert Metzger in Nürnberg die Verlegung der „Stolpersteine“. Ein dezentrales, internationales Erinnerungsprojekt des Künstlers Gunter Demnig. Dabei werden Namen und Schicksale von NS-Verfolgten in Messingtafeln graviert und vor ihren letzten Wohnorten in den Boden eingelassen. So wird Erinnerung dort sichtbar gemacht, wo diese Menschen einst lebten. Für Angehörige entsteht ein Ort des Gedenkens und der Trauer.
Wir haben mit dem Historiker ein längeres Gespräch geführt. Wenn Sie mehr Infos zu ihm und seiner Arbeit mit der Erinnerungskultur erhalten wollen, lesen Sie das vollständige Interview, welches im nächsten Abschnitt folgt. Interview Dr. Pascal Metzger
Wir haben mit dem Historiker ein längeres Gespräch geführt. Wenn Sie mehr Infos zu ihm und seiner Arbeit mit der Erinnerungskultur erhalten wollen, lesen Sie das vollständige Interview, welches im nächsten Abschnitt folgt. Interview Dr. Pascal Metzger
Vollbild
Was bedeutet „Erinnerungskultur“ für Sie persönlich?
In der Regel verwenden wir den Begriff „Erinnerungskultur“, wenn wir von der Zeit des Nationalsozialismus sprechen und wie wir heute damit umgehen. Aber das „Wir“ stellt bereits eine Problematik dar, denn jede und jeder hat seine eigenen Vorstellungen davon, was relevant ist, an was erinnert werden sollte und wie man damit umgeht. Mir als Historiker ist wichtig, sachlich zu informieren, Meinungen von Information zu trennen und über die Geschichte im Rahmen politischer Bildung zu sprechen. Das Gedenken an die Zeit des Nationalsozialismus ist Grundpfeiler unserer heutigen Republik und muss es auch bleiben. Deshalb ist fundiertes Wissen über die damaligen Ereignisse unerlässlich.
Welcher Aspekt ist Ihrer Meinung nach von Bedeutung, um die „Erinnerungskultur“ immer weiter zu beleben?
Wichtig ist mir sowohl die „Erinnerung“ an die Verbrechen des Nationalsozialismus als auch an die Mitwirkung und Zustimmung so vieler Menschen, die dieser Regierung, die diesem Regime bis zuletzt die Treue gehalten haben. Wenn wir uns heute mit der NS-Zeit beschäftigen, bieten Biografien wie bei den „Stolpersteinen“ einen guten Zugang. Über dieses Projekt werden die Namen der Menschen, die in unserem näheren Umfeld gelebt haben und völlig unschuldig Opfer des Nationalsozialismus wurden, wieder zurück in die Stadt geholt. Meine Erfahrung durch die Tätigkeit mit den Stolpersteinen ist es, dass Geschichte mithilfe von Biografien greifbar wird. Dadurch wird vieles, was in Büchern sehr abstrakt steht, ganz konkret und bekommt eine Verbindung zum eigenen Leben. Durch diesen Zugang wird das Interesse an dem Thema bei allen Altersgruppen geweckt.
Welche Rolle sollte „Erinnerungskultur“ in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung und des Erstarkens rechtsextremer Strömungen Ihrer Auffassung nach spielen?
„Erinnerung“ bedeutet auch, Fehler nicht zu wiederholen: Jeder von uns hat in seinem Leben negative Erfahrungen gemacht, denkt immer wieder an diese und versucht sie nicht zu wiederholen. So, wie es uns persönlich geht, so sollte es uns auch als Gesellschaft gehen. Wenn wir uns also anschauen, was in Deutschland stattgefunden hat und wie damit in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg umgegangen wurde, sollten wir daraus Lehren ziehen. Das ist einfach, denn wir haben inzwischen so viel Wissen dazu erforscht, das für alle zugänglich ist. Genauso bedeutend, wie es in den letzten Jahrzehnten war, sich dieser Geschichte immer wieder zu stellen und dafür Verantwortung zu tragen, dass die Erinnerung daran nicht verblasst, bleibt es auch für die Zukunft.
In der Regel verwenden wir den Begriff „Erinnerungskultur“, wenn wir von der Zeit des Nationalsozialismus sprechen und wie wir heute damit umgehen. Aber das „Wir“ stellt bereits eine Problematik dar, denn jede und jeder hat seine eigenen Vorstellungen davon, was relevant ist, an was erinnert werden sollte und wie man damit umgeht. Mir als Historiker ist wichtig, sachlich zu informieren, Meinungen von Information zu trennen und über die Geschichte im Rahmen politischer Bildung zu sprechen. Das Gedenken an die Zeit des Nationalsozialismus ist Grundpfeiler unserer heutigen Republik und muss es auch bleiben. Deshalb ist fundiertes Wissen über die damaligen Ereignisse unerlässlich.
Welcher Aspekt ist Ihrer Meinung nach von Bedeutung, um die „Erinnerungskultur“ immer weiter zu beleben?
Wichtig ist mir sowohl die „Erinnerung“ an die Verbrechen des Nationalsozialismus als auch an die Mitwirkung und Zustimmung so vieler Menschen, die dieser Regierung, die diesem Regime bis zuletzt die Treue gehalten haben. Wenn wir uns heute mit der NS-Zeit beschäftigen, bieten Biografien wie bei den „Stolpersteinen“ einen guten Zugang. Über dieses Projekt werden die Namen der Menschen, die in unserem näheren Umfeld gelebt haben und völlig unschuldig Opfer des Nationalsozialismus wurden, wieder zurück in die Stadt geholt. Meine Erfahrung durch die Tätigkeit mit den Stolpersteinen ist es, dass Geschichte mithilfe von Biografien greifbar wird. Dadurch wird vieles, was in Büchern sehr abstrakt steht, ganz konkret und bekommt eine Verbindung zum eigenen Leben. Durch diesen Zugang wird das Interesse an dem Thema bei allen Altersgruppen geweckt.
Welche Rolle sollte „Erinnerungskultur“ in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung und des Erstarkens rechtsextremer Strömungen Ihrer Auffassung nach spielen?
„Erinnerung“ bedeutet auch, Fehler nicht zu wiederholen: Jeder von uns hat in seinem Leben negative Erfahrungen gemacht, denkt immer wieder an diese und versucht sie nicht zu wiederholen. So, wie es uns persönlich geht, so sollte es uns auch als Gesellschaft gehen. Wenn wir uns also anschauen, was in Deutschland stattgefunden hat und wie damit in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg umgegangen wurde, sollten wir daraus Lehren ziehen. Das ist einfach, denn wir haben inzwischen so viel Wissen dazu erforscht, das für alle zugänglich ist. Genauso bedeutend, wie es in den letzten Jahrzehnten war, sich dieser Geschichte immer wieder zu stellen und dafür Verantwortung zu tragen, dass die Erinnerung daran nicht verblasst, bleibt es auch für die Zukunft.
Ehepaar Aal und Ingeborg Nora Aal
Vor dem Haus Alte Poststraße 3 wurden 28. Mai 2016 die
ersten drei Stolpersteine des Jahres für das Ehepaar Hermann und Friedl Aal
sowie ihre Tochter Ingeborg Nora Aal, verheiratete Stern, verlegt.
Dies ist zugleich das erste von vier Häusern in diesem Stadtviertel, die an die große Viehhändlerfamilie Aal erinnern, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Egenhausen bei Obernzenn nach Ansbach zog, um hier bessere Lebensbedingungen zu finden.
Hermann Aal wurde am 9. Februar 1907 in Egenhausen als Sohn des Viehhändlers Max Aal und Jette Aal, geb. Schülein, geboren. Nur wenige Häuser weiter in der Alten Poststraße 12 wurden ebenfalls Stolpersteine für seine Eltern verlegt.
Mit 18 Jahren zog Hermann am 7. August 1925 mit seinen Eltern nach Ansbach in die Alte Poststraße 12. Am 6. Oktober 1932 heiratete er die 23-jährige Friedl Waldmann aus Windsheim, und am 5. Oktober 1933 wurde ihre gemeinsame Tochter Ingeborg Nora geboren.
In der Alten Poststraße 3, wo früher die Gaststätte „Göckerle“ war, betrieb Hermann ab dem 16. Juni 1933 einen Vieh- und Pferdehandel. Zuvor war sein Geschäft in der Karolinenstraße 19 ansässig.
Das Familienglück währte nur kurz: Hermann Aal starb im Alter von nur 30 Jahren am 16. November 1937 in Fürth. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof in Ansbach beigesetzt, wo ihm nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gedenkstein gesetzt wurde.
Angesichts der schweren Situation und zunehmender nationalsozialistischer Verfolgung sah die junge Witwe Friedl Aal keine Zukunft mehr in Ansbach. Kurz vor der Reichspogromnacht verkaufte sie ihr Haus und emigrierte am 10. Juni 1938 mit ihrer Tochter Ingeborg Nora in die USA.
Die Fränkische Zeitung kommentierte die Auswanderung zynisch am 28. Mai 1938:
„Dieser Tage konnte man in der Alten Poststraße eine jener bekannten großen Arche-Noah-Kisten sehen, die für einen Überseetransport mosaischen Charakters bestimmt war. Wogegen unsererseits ganz und gar nichts einzuwenden ist!“
In New York, wo sie sich niederließen, fand Friedl mehr Glück. Sie heiratete erneut und trug fortan den Namen Bloomfield.
Am 21. Februar 1944 wurde sie US-amerikanische Staatsbürgerin. Nach dem Krieg erhob sie Ansprüche auf ihr ehemaliges Haus in der Alten Poststraße 3. Ihr Brief an die Vermögenskontrollstelle ist erhalten und endet mit einem Vergleich und einer Entschädigungszahlung im Jahr 1951.
Friedl Bloomfield verstarb am 23. September 2005 im Alter von 96 Jahren in New York.
Über ihre Tochter Ingeborg Nora, die den Nachnamen Stern annahm, ist bekannt, dass sie heiratete, doch weitere Informationen oder Nachkommen konnten bisher nicht ermittelt werden.
Die übrigen Familienmitglieder, darunter Hermanns ledige Schwester Jette und ihr verwitweter Vater Nathan, kamen ebenfalls nach Ansbach, starben jedoch beide kurz vor der Jahrhundertwende.
Auch Hermanns Schwester Jeanette Rosenfeld verstarb bereits 1925. Bemerkenswert ist auch das Grab von Therese Selling in der Maximilianstraße 14, die ebenfalls Repressalien in den 1930er-Jahren in Ansbach erleiden musste.
Sie starb 1937, bevor die Novemberpogrome begannen, und ruht heute auf dem jüdischen Friedhof neben ihrem Mann. Ihr Grabstein ist einer der wenigen Doppelgrabsteine auf dem Friedhof.
Dies ist zugleich das erste von vier Häusern in diesem Stadtviertel, die an die große Viehhändlerfamilie Aal erinnern, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Egenhausen bei Obernzenn nach Ansbach zog, um hier bessere Lebensbedingungen zu finden.
Hermann Aal wurde am 9. Februar 1907 in Egenhausen als Sohn des Viehhändlers Max Aal und Jette Aal, geb. Schülein, geboren. Nur wenige Häuser weiter in der Alten Poststraße 12 wurden ebenfalls Stolpersteine für seine Eltern verlegt.
Mit 18 Jahren zog Hermann am 7. August 1925 mit seinen Eltern nach Ansbach in die Alte Poststraße 12. Am 6. Oktober 1932 heiratete er die 23-jährige Friedl Waldmann aus Windsheim, und am 5. Oktober 1933 wurde ihre gemeinsame Tochter Ingeborg Nora geboren.
In der Alten Poststraße 3, wo früher die Gaststätte „Göckerle“ war, betrieb Hermann ab dem 16. Juni 1933 einen Vieh- und Pferdehandel. Zuvor war sein Geschäft in der Karolinenstraße 19 ansässig.
Das Familienglück währte nur kurz: Hermann Aal starb im Alter von nur 30 Jahren am 16. November 1937 in Fürth. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof in Ansbach beigesetzt, wo ihm nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gedenkstein gesetzt wurde.
Angesichts der schweren Situation und zunehmender nationalsozialistischer Verfolgung sah die junge Witwe Friedl Aal keine Zukunft mehr in Ansbach. Kurz vor der Reichspogromnacht verkaufte sie ihr Haus und emigrierte am 10. Juni 1938 mit ihrer Tochter Ingeborg Nora in die USA.
Die Fränkische Zeitung kommentierte die Auswanderung zynisch am 28. Mai 1938:
„Dieser Tage konnte man in der Alten Poststraße eine jener bekannten großen Arche-Noah-Kisten sehen, die für einen Überseetransport mosaischen Charakters bestimmt war. Wogegen unsererseits ganz und gar nichts einzuwenden ist!“
In New York, wo sie sich niederließen, fand Friedl mehr Glück. Sie heiratete erneut und trug fortan den Namen Bloomfield.
Am 21. Februar 1944 wurde sie US-amerikanische Staatsbürgerin. Nach dem Krieg erhob sie Ansprüche auf ihr ehemaliges Haus in der Alten Poststraße 3. Ihr Brief an die Vermögenskontrollstelle ist erhalten und endet mit einem Vergleich und einer Entschädigungszahlung im Jahr 1951.
Friedl Bloomfield verstarb am 23. September 2005 im Alter von 96 Jahren in New York.
Über ihre Tochter Ingeborg Nora, die den Nachnamen Stern annahm, ist bekannt, dass sie heiratete, doch weitere Informationen oder Nachkommen konnten bisher nicht ermittelt werden.
Die übrigen Familienmitglieder, darunter Hermanns ledige Schwester Jette und ihr verwitweter Vater Nathan, kamen ebenfalls nach Ansbach, starben jedoch beide kurz vor der Jahrhundertwende.
Auch Hermanns Schwester Jeanette Rosenfeld verstarb bereits 1925. Bemerkenswert ist auch das Grab von Therese Selling in der Maximilianstraße 14, die ebenfalls Repressalien in den 1930er-Jahren in Ansbach erleiden musste.
Sie starb 1937, bevor die Novemberpogrome begannen, und ruht heute auf dem jüdischen Friedhof neben ihrem Mann. Ihr Grabstein ist einer der wenigen Doppelgrabsteine auf dem Friedhof.
Scrollen, um weiterzulesen
Wischen, um weiterzulesen
Wischen, um Text einzublenden




















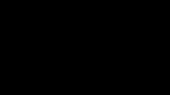





























 Erinnerungskultur in Nürnberg und Ansbach
Erinnerungskultur in Nürnberg und Ansbach
 Auswahl Hotspots
Auswahl Hotspots
 Zitate
Zitate
 Danksagung
Danksagung
 Credits
Credits
 Impressum
Impressum
 Gunter Demnig
Gunter Demnig
 Erinnerungskultur beleben
Erinnerungskultur beleben
 Routine
Routine
 Besonderer Stolperstein
Besonderer Stolperstein
 Stolperstein-Verlegung
Stolperstein-Verlegung
 Stolperstein-Karte
Stolperstein-Karte
 Zitat
Zitat
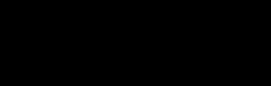 Interview Gunter Demnig
Interview Gunter Demnig
 Auguste Weinschenk
Auguste Weinschenk
 Familie Steiner und Karoline Schloss
Familie Steiner und Karoline Schloss
 Familie Dietenhöfer
Familie Dietenhöfer
 Ehepaar Gutmann
Ehepaar Gutmann
 Therese Selling
Therese Selling
 Frida Neuburger
Frida Neuburger
 Regina und Armin Weiss
Regina und Armin Weiss
 Ehepaar Lehmann
Ehepaar Lehmann
 Dr. Berthold Daniels und Elise Daniels
Dr. Berthold Daniels und Elise Daniels
 Familie Joel und Flora Schwab
Familie Joel und Flora Schwab
 Familie Welsch
Familie Welsch
 Familien Kohn, Seeberger und Stefansky
Familien Kohn, Seeberger und Stefansky
 Familie Weissmann
Familie Weissmann
 Familie Stühler
Familie Stühler
 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände
 PD Dr. Imanuel Baumann
PD Dr. Imanuel Baumann
 Erinnerungskultur beleben
Erinnerungskultur beleben
 Erinnerungskultur in Zeiten rechtsextremer Strömungen
Erinnerungskultur in Zeiten rechtsextremer Strömungen
 Beschäftigung mit NS-Geschichte in unsicheren Zeiten
Beschäftigung mit NS-Geschichte in unsicheren Zeiten
 Aktuelle Ausstellung
Aktuelle Ausstellung
 Aktuelle Ausstellung
Aktuelle Ausstellung
 Archiv-Bilder
Archiv-Bilder
 Seite 1
Seite 1
 Seite 2
Seite 2
 Seite 3
Seite 3
 Seite 4
Seite 4
 Dr. Pascal Metzger
Dr. Pascal Metzger
 Hotspots
Hotspots
 Ehepaar Aal und Ingeborg Nora Aal
Ehepaar Aal und Ingeborg Nora Aal